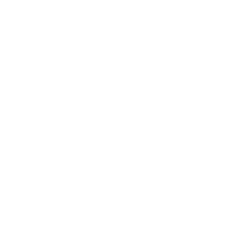magazine_ Reportage
Abgelegen, aber nicht abgehängt
Welche Grundversorgung brauchen Berggebiete, damit die Menschen nicht abwandern?
In Moos im Passeier ist der Genossenschaft EUM gelungen, was für andere dünn besiedelte, periphere Berggebiete ein Modell sein kann: kostengünstig wichtige Dienstleistungen anzubieten.
Schule, Lebensmittelladen, Arzt: Wie kann man in ländlichen Gebieten eine Grundversorgung sichern, die bezahlbar ist und den Bedürfnissen der Bewohner entspricht? Forscher aus dem gesamten Alpenraum arbeiten gemeinsam an Strategien.
Tief im Tunnel des Kraftwerks Rabenstein, als Hubert Brunner seinen Bericht beendet hat, die Zahlen genannt, ist der junge Besucher aus der Schweiz sich sicher: Vor ihm steht ein Held. „Chapeau! Mit deinen Ideen und deinem Enthusiasmus hast für die Gemeinde einen massiven Mehrwert geschaffen!“ Es ist kalt hier an diesem Januartag, doch der Regionalentwicklungsexperte aus Bern glüht vor Begeisterung: „Das ist für mich soziale Innovation.“ Auf Hubert Brunners Gesicht konkurrieren Stolz und Verlegenheit. Fünfzehn Jahre lang war er Geschäftsführer der Genossenschaft „Energie Umwelt Moos(EUM)“, er hat sie miterdacht und ihren Ausbau geleitet, „jedes Jahr kam etwas Neues dazu“. Zur Stromversorgung ein Heizwerk, eine Tankstelle, zwei Dorfläden, Internet. Der Strompreis liegt 60 Prozent unter dem italienischen Durchschnitt; die Tankstelle ist die günstigste im Umkreis und verkauft vier Mal so viel Benzin wie vor der Übernahme durch die Genossenschaft. Das alles erzählt Brunner den Besuchern, er ist im Ruhestand, aber Führungen macht er noch manchmal. Heute sind es zwei Dutzend Experten aus dem ganzen Alpenraum, die der Bus ins abgeschiedene Hinterpasseier gebracht hat – immer tiefer hinein in die verschneiten Bergfalten, auf steiler Straße und in engen Kurven, bis nach Rabenstein: Fraktion von Moos, gut 200 Einwohner, eine Schule mit fünfzehn Kindern, zwei Gasthäuser. Wie kann man solche Orte in den Alpen lebendig erhalten? Wie eine Versorgung garantieren, die den Bedürfnissen der Bewohner entspricht und für die öffentliche Hand bezahlbar ist? Das sind die Fragen, die die Fachleute hierher geführt haben, auf die sie Antworten suchen im Rahmen eines europäischen Forschungsprojekts (s. Kasten). EUM ist ein Beispiel, das nicht nur den jungen Schweizer beeindruckt. „Eine klare Win-Win-Situation“, murmelt jemand in der Gruppe, als ein junger Elektrotechniker der Genossenschaft erzählt, wie er nach Ausbildung in Innsbruck und Arbeit in der Schweiz wieder nach Moos zurückkam: Jetzt betreut er für die EUM im Schichtdienst die Stromversorgung, den Laptop auf dem Nachttisch, und ist Vater von vier Kindern. Neunzehn Angestellte hat die Genossenschaft inzwischen. „Hier ist etwas gelungen, was für viele abgelegene, dünn besiedelte Gebiete ein Modell sein kann“, sagt Christian Hoffmann, Experte für Regionalentwicklung von Eurac Research. „Nämlich nicht in den üblichen Kompartimenten zu denken: Ein Dienstleister sorgt für Energie, ein anderer für die Nahversorgung etc.. In Zukunft wird es darum gehen, Synergien zu nutzen und über regionale, administrative und sektorale Grenzen hinweg eine bedarfsorientierte Serviceleistung zu erbringen.“ Für neue Strategien aber braucht es zuerst eine Diagnose: Wo liegen die Schwachstellen, was sind Potenziale? Neun Testgebiete in fünf Alpenstaaten haben Hoffmann und seine Kollegen von Eurac Research deshalb eingehend durchleuchtet – haben untersucht, welche Dienste angeboten werden, wie sie verteilt sind, wie leicht oder schwierig zu erreichen; und sie haben die Menschen gefragt, wie sie selbst die Situation beurteilen.
Soll man potenzialarme Landesteile als alpine Brache abschreiben?
Hoffmann, innerlich schon darauf vorbereitet, womöglich „desaströse Zustände“ anzutreffen, war vom Ergebnis positiv überrascht: Die Untersuchung offenbarte nicht deprimierte Landstriche, die sich abgehängt fühlen von boomenden Zentren; Lücken in der staatlichen Versorgung füllt oft beträchtliches Bürgerengagement – etwa wenn Eltern selbst einen Busdienst zum Kindergarten organisieren, wenn Freiwillige Alte und Kranke mit Mahlzeiten versorgen. Und doch zeichnet sich in all den Statistiken und Erhebungen auch unübersehbar die Gefahr einer schleichenden Auszehrung ab. Die Jungen ziehen weg oder arbeiten auswärts, kaufen dann auch auswärts ein, bringen die Kinder womöglich am Arbeitsort in die Krippe; immer mehr Leben fließt in neuen Kanälen, die alten trocknen aus. Läden schließen, Postfilialen werden aufgegeben, für einen Arzt reichen die Patienten nicht aus. Beginnt die Abwärtsspirale damit, dass Dienste eingestellt werden, weil es nicht genug Nutzer gibt – oder wandern Einwohner ab wegen mangelnder Versorgung? Und dann ist da noch eine andere große Frage, die europaweit immer lauter gestellt wird: Inwieweit ist es die Aufgabe der öffentlichen Hand, in dünn besiedelten, peripheren Gebieten gleichwertige Lebensbedingungen zu schaffen, und was darf es kosten? Die Antwort darauf sah in den Alpen je nach Staat und historischem Moment ganz unterschiedlich aus. Während Frankreich seit jeher aktiv auf Zentralisierung setzte, nahm Italien es eher wie ein Naturgesetz hin, dass Turin und Mailand die ligurischen und piemontesischen Täler leersaugten; selbst die Schweiz, traditionell einem dezentralen Besiedelungsmodell verpflichtet, diskutierte vor Jahren einmal heftig darüber, ob man „potenzialarme“ Landesecken nicht als „alpine Brache“ abschreiben solle und dafür mehr Geld für Zürich und Basel ausgeben – aus der Perspektive des globalen Wettbewerbs die bessere Investition.
In Südtirol gilt seit Alfons Benedikter die Devise: Was getan werden kann, um die Menschen in den Tälern und Dörfern zu halten, wird getan. Und dank Autonomie und finanzieller Mittel war es auch möglich, sie umzusetzen. Bisher sind hier Bilder schwer vorstellbar, wie Hoffmann sie etwa in Graubünden sah: aufgegebene Ställe mitten im Dorf, eine wegen Kindermangels aufgelöste Schule mit neuer Turnhalle, die nur noch manchmal als Mehrzweckhalle Verwendung findet.
Der demographische Wandel hängt mancherorts wie ein Damoklesschwert über den Dörfern
Doch auch in einer Provinz, in der Lebensmittelläden in peripheren Ortschaften Zuschüsse erhalten und die Landesregierung zehn Millionen Euro ausgibt, um sicherzustellen, dass in den nächsten Jahren kein Postamt schließt, ist es gut, sich beizeiten über die Zukunft Gedanken zu machen. Weil es hier wie überall darum gehen muss, öffentliche Mittel möglichst effizient einzusetzen. Und weil hier, wie überall, die Menschen immer älter werden. Der demografische Wandel trifft das Land härter als die Stadt; die Experten reden darüber wie über ein Damoklesschwert, das mancherorts über den Dörfern hängt.
Womit genau zu rechnen ist, haben die Forscher von Eurac Research in Bevölkerungsprognosen für sämtliche Testgebiete ausgerechnet. Bei allen Unterschieden zwischen den Regionen, das Ergebnis ist eindeutig: Bis 2030 geht der Anteil der unter 14jährigen stark zurück, in manchen Gegenden um 40, 50 Prozent, während jener der über 65jährigen ansteigt. Wie soll man die alten Menschen auf dem Land gut versorgen? Eine Hoffnung ist: Mit Hilfe von Internet und Digitalisierung. Wie das aussehen könnte, bekommen die Experten am Tag nach der Exkursion im Konferenzraum von Eurac Research präsentiert. In Tirol testet der Sozial- und Gesundheitssprengel Ausserfern ein „digitales Gesundheitstagebuch“: Alte Menschen, die zuhause leben, übertragen über einen Sensor täglich ihre Werte auf einen Server, die Mitarbeiter des mobilen Pflegedienstes können darauf zugreifen und bei Unregelmäßigkeiten schnell reagieren. Auch andere Regionen wollen in der medizinischen Versorgung zunehmend auf begleitende IT-Lösungen setzen.
Schnelles Internet, da sind sich alle einig, ist für die Zukunft abgelegener Gebiete von enormer Bedeutung. Telearbeit, Online-Einkauf, smarte Verwaltung: Weil im virtuellen Raum keine „Kosten der Weite“ anfallen, könnte Breitband der große Gleichmacher sein – in kühnen Visionen unterstützt von Technologien wie selbstfahrenden Autos, die die Einkäufe nach Hause bringen. Dass bis dahin noch Dorfläden übrig sind, die dadurch bedroht werden könnten, ist ohnehin nicht sonderlich wahrscheinlich. Außer sie verwandeln sich, sind nicht mehr nur Laden, sondern gleichzeitig Bar, Postamt, Treffpunkt. Das ist dann ebenfalls eine integrierte Lösung, wenn auch keine wirklich neue. „So war es ja früher schon mal“, sagt eine Ökonomin aus Slowenien lachend, „wir erfinden da gerade das Rad neu.“ Auch die Lebensmittelläden der EUM in Moos dienen gleichzeitig als Postannahmestelle. Doch das Geschäft geht eher schlecht. Die guten Straßen, das ausgezeichnete öffentliche Verkehrssystem mit halbstündlichen Bussen – „da fahren die Frauen halt auch in die Stadt, um im großen Supermarkt einzukaufen.“ Das sagt der Genossenschaftsmann Brunner, unüberhörbar mit einer resignierten Note. „Mit den Preisen dort können wir natürlich nicht konkurrieren.“ Er sieht ein bisschen ratlos aus. Doch insgesamt ist er zufrieden. Moos wurde in einer Studie der Handelskammer von 2011 als eine von dreizehn Südtiroler Gemeinden mit „deutlichen strukturellen Schwächen“ und deshalb erhöhter Abwanderungsgefahr identifiziert, und Brunner ist überzeugt, die EUM habe beigetragen, diese Gefahr zu verringern. An Kindern mangelt es auch nicht, fünf Grundschulen gibt es in der Gemeinde. In die Mittelschule geht es dann nach St. Martin. Als die Experten schon wieder auf der Rückfahrt sind, kreuzen sie die Mittelschüler, die vom Nachmittagsunterricht zurückkommen. „Zwei volle Busse!“, bemerkt ein Verkehrsexperte aus Mailand anerkennend. „Hier ist noch Leben. In der Lombardei oder im Piemont in vielen Tälern nicht mehr.“