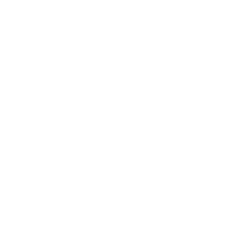magazine_ Article
Die Geheimnisse einer Dame aus Basel
Eine gut erhaltene Kirchenmumie aus dem 18. Jahrhundert erweist sich in vielerlei Hinsicht als faszinierendes Forschungsobjekt
Die Hände der Mumie sind wie der Großteil des Körpers gut erhalten. Große Hautfalten zeigen, dass die Dame sehr füllig war.
1975 wurde in der Basler Barfüsserkirche eine Frauenmumie gefunden, deren Identität über Jahrzehnte ein Rätsel blieb. Mithilfe genetischer Analysen konnte ein Forschungsteam von Eurac Research entscheidend zu seiner Lösung beitragen. Wer die Dame war, ist also beantwortet – die Mumienforschung hat aber noch ganz andere Fragen.
Als Bauarbeiten in der Basler Barfüsserkirche 1975 ein Grab mit einer gut erhaltenen Frauenmumie ans Licht bringen, weiß man mit Sicherheit nur so viel: Wer immer die Dame war – sie war wer. Jemand von gesellschaftlichem Rang, eine Frau der Oberschicht. Außer der Kurie kam nur den wichtigsten Familien das Privileg zu, innerhalb der Kirchenmauern die letzte Ruhe zu finden. Erste Untersuchungen weisen in die gleiche Richtung: Um den kleinen Körper – sie ist nur 142 cm groß – hängt die Haut in großen Falten, was auf beachtliche Leibesfülle schließen lässt; die Galle, wie alle Organe gut erhalten, ist bis zum Platzen mit Steinen gefüllt. Alles spricht dafür, dass die Dame im Lauf ihres Lebens reichlich fette Fleisch- und Süßspeisen genossen hatte. Nicht die Kost der kleinen Leute. Eine Erklärung für die Mumifizierung ist auch bald gefunden: Die entnommenen Proben enthalten Quecksilber in hoher Konzentration, was den Verfall offenbar verhindert hatte. Quecksilber wurde in Europa jahrhundertelang zur Behandlung von Syphilis eingesetzt – eine Erkrankung, auf die auch Verformungen an den Schädelknochen hinzuweisen scheinen.
Aber wer war die Frau? Jahrzehntelang bewahrt die Mumie ihr Geheimnis, doch 2015 startet ein interdisziplinäres Forschungsteam unter Leitung des Anthropologen Gerhard Hotz einen neuen Versuch, es zu entschlüsseln. Archive werden durchgekämmt, Beerdigungsregister, Grabsteinlisten, Leichenreden studiert, eine engagierte Gruppe der Basler „Bürgerforschung“ transkribiert hunderte historischer Dokumente. Ohne Erfolg. Irgendwann aber würden die Recherchen zu einem Namen führen, hofft man in Basel, und vielleicht wären sogar lebende Nachfahren ausfindig zu machen: Dann könnte ein DNA-Vergleich Sicherheit bringen. In dieser Hoffnung wendet Hotz sich an das Institut für Mumienforschung von Eurac Research, in Europa eine der renommiertesten Forschungseinrichtungen für die Analyse alter DNA, mit so prominenten Untersuchten wie Tutankhamun und Ötzi. Am 6. Juni 2016 entnimmt Institutsleiter Albert Zink der Mumie aus der Barfüsserkirche einen Vorbackenzahn.
In alten menschlichen Überresten steckt viel DNA – aber meist stammt nur ein kleiner Teil davon vom betreffenden Menschen
„Mit diesem Zahn habe ich dann hauptsächlich gearbeitet“, erklärt die Molekulargenetikerin Christina Wurst, die sich in den vergangenen Jahren intensiv mit der Basler Mumie befasst hat. „In den Zähnen und im Felsenbein findet man nämlich am meisten endogene DNA.“ Endogen heißt, dieses Erbgut stammt tatsächlich von dem untersuchten Organismus, und in dem komplexen DNA-Gemisch, das sich in menschlichen Überresten findet, ist es so etwas wie die Nadel im Heuhaufen: Bis zu über 99 Prozent der extrahierten Gesamt-DNA kann „Hintergrundkontamination“ sein – Erbgut von Mikroorganismen, die den Organismus schon zu Lebzeiten besiedelten oder nach dem Tod in ihn eindrangen, oder genetische Spuren heutiger Menschen, die mit den Überresten in Kontakt kamen. Die erste Herausforderung für Christina Wurst ist also, aus dem Zahn genügend DNA der Dame zu gewinnen.
Sie sucht nach dem Erbgut in den Mitochondrien, den Zellkraftwerken. Die mitochondriale DNA wird ausschließlich von der Mutter an die Kinder vererbt, womit sich Verwandtschaftsverhältnisse viel leichter nachverfolgen lassen. Und noch einen Vorteil hat das Mitogenom für Forschungszwecke: Anders als beim Kerngenom kann eine Zelle über tausend Kopien der mitochondrialen DNA enthalten. Das ist von Bedeutung, weil alte DNA in schlechtem Zustand ist – sobald ein Organismus stirbt, beginnen die langen Nukleotidketten zu zerfallen, und was aus Knochen oder Zähnen extrahiert werden kann, sind häufig nur noch kleine Schnipsel. Eine hohe Kopienzahl erhöht die Chance, auch bei sehr degradierter DNA noch genügend Bruchstücke für die Sequenzierung zu finden.
Im Bozner Labor behandelt Wurst den Zahn mit einer Hypochloridlösung und bestrahlt ihn mit UV-Licht, um die größten Verunreinigungen in den Außenschichten zu entfernen, dann zermahlt sie ihn zu feinem Pulver. Um das Risiko der Kontamination möglichst klein zu halten, müssen Labore für alte DNA strengen Reinraum-Vorschriften entsprechen. Arbeitsflächen und Materialien werden mit UV-Licht und Wasserstoffperoxid behandelt, Forscherinnen und Forscher tragen Ganzköperanzüge, Mundschutz, Handschuhe, Brillen (die Wissenschaft kann allerdings im Anschluss bioinformatisch alte DNA an charakteristischen Schadmustern erkennen und somit sicherstellen, dass ein Ergebnis nicht von entwischter Forscher-DNA beeinflusst wurde). Ein noch größeres Problem aber als Kontamination – „obwohl die natürlich ein riesiges Problem ist“ –, sei die Fragmentierung, sagt Wurst. „Manchmal haben wir Fragmente, die nur 25 oder 30 Basenpaare lang sind“ (Kern-DNA umfasst über drei Milliarden Basenpaare, mitochondriale DNA fast 17.000). Vor 15 Jahren noch wäre mit solchen Proben nicht viel anzufangen gewesen, für wissenschaftliche Analysen brauchte man Fragmente von mindestens 60 bis 70 Basenpaaren. Doch die Technologie in diesem Bereich hat spektakuläre Fortschritte gemacht; mit Next Generation Sequencing können heute simultan mehrere hundert Millionen Fragmente in einer Probe sequenziert werden. Außerdem wendet Wurst noch eine spezielle Methode an, um den Anteil von Mumien-DNA in der Probe zu vergrößern, sie „anzureichern“. Dazu werden synthetisch hergestellte Sequenzen menschlicher DNA dazugegeben, an welche sich die kleinen Fragmente der Mumien-DNA anlagern und dann mithilfe eines Magneten herausgefischt werden können, erklärt Wurst: „Die Prozedur ist natürlich komplexer, doch das ist das Prinzip.“ Die herausgefischten Fragmente werden dann vervielfältigt. „Am Ende ist immer noch Hintergrundkontamination dabei, aber die Probe enthält einen viel größeren Anteil des für uns interessanten Erbguts.“ Die Analyse des Mitogenoms ergibt, dass die Dame einer sehr alten, heute in Europa seltenen Haplogruppe angehört.
An Syphilis starb die Pfarrersfrau nicht, vielleicht jedoch an der Behandlung
Inzwischen ist in Basel tatsächlich die erhoffte Spur aufgetaucht. Eine Aktennotiz aus dem Jahr 1843, als die Mumie schon einmal gefunden und neu begraben worden war, lässt vermuten, dass es sich um die Pfarrersfrau Anna Catharina Bischoff handelt, geboren 1719 in Straßburg und 1787 in Basel verstorben. Endlich gibt es eine Kandidatin. Die 14C-Datierung von Kleiderresten und Körperproben passt auf sie, auch das anhand von Gelenken geschätzte Sterbealter. Nun gilt es, eine weibliche Linie bis in die Gegenwart zu finden, zu heutigen Nachfahren. Die Pfarrersfrau hatte sieben Kinder geboren, doch nur zwei Töchter überlebten bis ins Erwachsenenalter; eine von ihnen blieb kinderlos, die andere hatte drei Söhne: Damit bricht die mütterliche Linie ab. Als die Genealoginnen aber über Anna Catharina Bischoffs Mutter, Großmutter, Urgroßmutter usw. sieben Generationen zurückgehen, gelangen sie schließlich zu einer Vorfahrin im 16. Jh., von der tatsächlich eine weibliche Linie über 15 Generationen bis in die Gegenwart führt, zu zwei betagten in Basel lebenden Geschwistern. „In akribischer Arbeit haben die Genealoginnen einen Stammbaum mit über 200 Menschen erstellt“, erzählt Wurst beeindruckt. (Auch eine Verwandtschaft zwischen der Basler Pfarrersfrau und Boris Johnson offenbaren die Recherchen). Die Geschwister stimmen einem DNA-Vergleich zu, es werden Speichelproben für die Analyse entnommen.
Die Ergebnisse bestätigen die Hypothese. Die Dame aus der Gruft und das Basler Geschwisterpaar teilen 25 identische Genveränderungen, darunter zwei sehr selten gemeinsam auftretende Genmutationen. Theoretisch könnte die Übereinstimmung auch Zufall sein, doch ist dies 8000 mal unwahrscheinlicher als eine Verwandtschaft, wie eine statistische Analyse zeigt. „Und weil alles zusammenpasst – die genetischen, historischen und genealogischen Ergebnisse – können wir wirklich davon ausgehen, dass es sich um Anna Catharina Bischoff handelt. Die Zusammenarbeit der Disziplinen war der Schlüssel.“
Das Rätsel der Identität ist also gelöst. Das ist ein wichtiges Ergebnis in mehrerer Hinsicht: Zum ersten Mal ist es gelungen, über 22 Generationen hinweg eine Verwandtschaft nachzuweisen, was auch das Potenzial genetischer Analysen für die historische Forschung bekräftigt (ähnliche Analysen haben enthüllt, dass ein vermeintlicher Nachfahre Richard III gar nicht sein Nachfahre war, erzählt Wurst). Außerdem kennt man mit der Identität nun auch die Zeit- und Lebensumstände, und kann weitere Forschungsergebnisse damit in Zusammenhang bringen. Denn der Fall ist keineswegs abgeschlossen. „Die Identifizierung war nur der erste Schritt“, sagt Wurst. „Wir haben noch viel mehr untersucht.“ Sie selbst zum Beispiel das mögliche Aussehen der Dame. Leider sind die genetischen Informationen in dieser Hinsicht dürftig, aber es ist trotzdem gelungen, die Vorstellung von der Pfarrersfrau konkreter zu machen: „Dunkle Haare, braune oder grüne Augen, höchstwahrscheinlich Sommersprossen.“
Eine andere Frage, der man nachgeht, ist die nach der Todesursache. Starb die Pfarrersgattin wirklich an Syphilis? Das Basler Forschungsteam ist sich dessen fast sicher und bittet das Bozner Institut 2016 um eine weitere DNA-Untersuchung, diesmal, um genetische Spuren des Syphiliserregers zu finden (die Hintergrundkontamination einer Studie kann in einer anderen im Vordergrund des Interesses stehen). „Wir haben sehr viele Gewebeproben untersucht, aus allen Teilen des Körpers“, erklärt der Mikrobiologe Mohamed Sarhan, „aber wir haben keine Spur des Syphiliserregers gefunden.“ Daran sei die Dame also mit Sicherheit nicht gestorben. „Aber vielleicht an der Behandlung. Die Quecksilberkonzentration im Gehirn war extrem hoch. Quecksilber wurde zur Behandlung von vielen Infektionen verwendet.“
Und hier machen die Forscher eine interessante Entdeckung. In der Probe aus dem Gehirn finden sie viel DNA eines Bakteriums der Gattung Mykobakterium, so viel, dass sie das komplette Genom rekonstruieren können. Ein typisches Mykobakterium ist der Tuberkuloseerreger, doch hier handelt es sich um ein nichttuberkulöses Mykobakterium – diese Keime kommen häufig auch im Boden oder Wasser vor, können bei immungeschwächten Menschen aber Lungenentzündungen und andere Infektionen auslösen. „Seit sich die Analysemethoden in der Klinik verbessert haben, entdeckt man immer öfter, dass eine Infektion mit diesen Bakterien hinter bestimmten Krankheitsbildern steckt“, erklärt Mohamed Sarhan. Das bei der Dame entdeckte Bakterium mit heutigen Stämmen zu vergleichen, kann der Wissenschaft Einblicke in Entwicklungen und Anpassungen von Pathogenen bringen. Und im Hinblick auf noch ein Bakterium ist die Dame ein Glücksfall: im Magen hatte sie den Keim Helicobacter pylori. Dieser kann zur Entzündung der Magenschleimhaut und unbehandelt zu einem Magengeschwür führen. Sein Genom hat das Institut schon rekonstruiert, nun wird untersucht, wie es sich von dem bei Ötzi gefundenem Keim unterscheidet, wie ähnlich es jenem heutiger Europäer ist. Auch Christina Wurst forscht an der Basler Dame weiter. Sie schließt sie in eine große Studie zur genetischen Prädisposition für Atherosklerose ein, in deren Rahmen sie schon ägyptische, australische und südamerikanische Mumien analysiert hat. Anna Catharina Bischoff hatte verkalkte Gefäße, und offenbar war nicht nur die Ernährung Schuld: In ersten Untersuchungen konnte Wurst in verschiedenen Genen Varianten nachweisen, die mit einem erhöhten Atherosklerose-Risiko verbunden sind.
Das Forschungsteam in Basel hatte gehofft, Briefe oder Tagebücher von Anna Catharina Bischoff zu finden, doch bislang ist nichts aufgetaucht. Vielleicht schrieb die Dame nicht, oder es hat nicht überdauert. Nur die Mumie kann also Auskunft geben. Und forschend befragt, erzählt sie viel.
 technical documentation
technical documentationPublikationen
Wie die Identität der Mumie durch Vergleich ihrer mitochondrialen DNA mit jener lebender Nachfahren bestätigt wurde, legt das Forschungsteam im Detail in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung in der Fachzeitschrift "Forensic Science International: Genetics" dar: https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2021.102604
Ein Buch für das allgemeine Publikum beschreibt die interdisziplinäre Spurensuche rund um die Mumie: Gerhard Hotz, Claudia Opitz-Belakhal (Hg.) "Anna Catharina Bischoff. Die Mumie aus der Barfüsserkirche Rekonstruktion einer Basler Frauenbiografie des 18. Jahrhunderts"