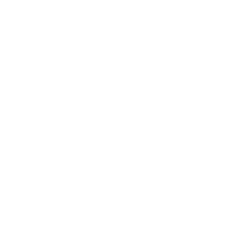magazine_ Article
Gehirn in Gefahr?
Sauerstoffmangel im Kopf kann zu schweren Schäden führen, die Bedrohung ist aber schwierig zu messen. Ein junger Forscher erprobt neue Ansätze.
Ultraschalltuntersuchung während einer Studie im terraXcube; im Extremklimasimulator kann unter kontrollierten Bedingungen untersucht werden, wie der menschliche Körper auf Sauerstoffmangel reagiert.
Sauerstoffmangel in Gehirn, häufig Ursache bleibender neuronaler Schäden, tritt bei der Hälfte aller schwerkranken Menschen in Intensivstationen auf. Noch gibt es dafür keinen einfachen und zuverlässigen Gradmesser. Kai Riemer, Experte für Ultraschall, will ihn entwickeln. An seiner Methode arbeitet er mit Hilfe von Gesunden, die er im terraXcube in dünne Luft versetzt.
Bevor Kai Riemer vergangenen Juni nach Südtirol zog, als Wissenschaftler vom terraXcube angezogen und als leidenschaftlicher Wanderer und Fotograf von den Bergen, forschte er viele Jahre in London. Das könnte der Ursprung seines Understatements sein (nachdem er seine Ausführungen bestens dem Verständnisniveau von Laien angepasst hat, entschuldigt er sich beispielsweise, er könne „nicht so gut erklären“). Mit Sicherheit auf seine Forschungsarbeit in London zurückzuführen ist Riemers Begeisterung für Ultraschall: ein vielseitiges, mobiles – die kleinsten Geräte sind mittlerweile nicht größer als ein Handy – und kostengünstiges Diagnoseinstrument, wie er erklärt, das lange an die Grenzen mangelnder Computerkapazitäten stieß, aber nun, mit immens verbesserten und immer besser werdenden Computern „keine Limitationen hat“. Am Londoner Imperial College, wo er promovierte und später in verschiedenen Laboren forschte, wurde er zum Experten für Blutfluss-Bildgebung und Superresolution-Ultraschallbildgebung.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Sauerstoffmangel zu beheben. Doch um sie zu bewerten, muss man die Veränderungen, die sie bewirken, erst einmal messen können.
Kai Riemer
Diese Expertise wendet er nun als Marie-Curie-Stipendiat am Institut für Alpine Notfallmedizin auf ein Problem an, das viele schwerkranke Menschen ebenso betrifft wie Bergsteiger: Sauerstoffmangel im Gehirn. Konkret arbeitet er an Methoden, die zerebrale Hypoxie, die dauerhafte neuronale Schäden und schlimmstenfalls den Hirntod verursachen kann, auf nicht invasive und einfache Weise zuverlässig zu quantifizieren. Soweit sein Ziel für die nächsten zwei Jahre. In der Ferne hat er sich aber schon das nächste gesteckt: „Was ich eigentlich will, ist Hypoxie heilen, also den Sauerstoffmangel beheben. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Doch um zu bewerten, wie gut sie sich eignen, muss man die Veränderungen, die sie bewirken, erst einmal messen können.“
Tritt Hypoxie bei gesunden Menschen auf, weil sie in Höhen aufsteigen, wo ihr Körper weniger Sauerstoff zur Verfügung hat, ist das Gegenmittel einfach: in tiefere Lagen absteigen. Wann das angeraten ist, wird am Berg meist mit einem Fragebogen ermittelt: Haben Sie Kopfschmerzen? Ist Ihnen schwindlig? „Das ist qualitativ, nicht quantitativ, und beruht rein auf der subjektiven Einschätzung.“ In Intensivstationen dagegen beurteilen Ärzte mit Hilfe einer Ultraschallaufnahme des Sehnervs, inwieweit der Sauerstoffmangel im Kopf zu erweiterten Gefäßen und dadurch erhöhten Hirndruck geführt hat. Auch diese Methode sei aber nicht wirklich objektiv, erklärt Riemer: „In der Fachliteratur ist eigentlich unstrittig, dass die Ergebnisse sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wer die Untersuchung durchführt. Manche Ärzte sehen keinen Effekt, andere einen großen.“ Diese mangelnde Eindeutigkeit könnte damit zusammenhängen, dass die Ultraschallaufnahmen zweidimensional sind, vermutet Riemer, und dies zu prüfen ist ein Teil seines Forschungsvorhabens. „Gemessen wird der Durchmesser der sogenannten Sehnervenscheide, das ist eine Art Hülle um den Nerv; man geht also davon aus, dass das ein perfekter Zylinder ist. Wenn dem aber nicht so ist? Liefert dann vielleicht eine dreidimensionale Aufnahme eine genauere Einschätzung? Das weiß ich noch nicht: Es ist nur ein Vorschlag.“
Und er hat noch einen zweiten Vorschlag – „weil ja beides auch schiefgehen kann.“ Dabei geht es nicht darum, eine bestehende Methode zu verbessern, sondern eine völlig neue zu entwickeln; und was herangezogen wird, um Rückschlüsse auf die Hypoxie im Kopf zu ziehen, ist nicht der Sehnerv, sondern der Blutfluss. Beide sind sogenannte „Surrogate“ für die Hypoxie: einfacher zu messende Parameter, die zuverlässig auf die Größe hinweisen, die man eigentlich beobachten will – „so, wie der Schatten eines Baums auf den Baum: Verschwindet der Schatten, können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass der Baum nicht mehr steht“, sagt Riemer. Und mit einem ähnlich anschaulichen Vergleich beschreibt er die Ausbreitung der Pulswelle, auf die sich seine neu erdachte Methode stützen soll: „Bringt man einen Gartenschlauch mit einer Bewegung zum Schlängeln, dann läuft die Welle durch den Schlauch, und am Ende angekommen, wird sie wieder reflektiert. Die Ausbreitung dieser Welle kann man messen und berechnen. Bei der Pulswelle verändert sie sich je nachdem, wie starr oder elastisch die Gefäße sind, oder auch wie groß. Und da sich bei Hypoxie die Gefäße im Kopf ausweiten, erwarte ich, dass man diese Veränderung an der Ausbreitung der Pulswelle erkennen kann.“ Das sei „sehr spekulativ“, fügt er hinzu: „Gut begründet, aber spekulativ.“ Die Ultraschallmessung wäre bei dieser Methode viel einfacher als am Auge, das Gerät müsste höchstens dreißig Sekunden am Hals angelegt werden. Funktioniert es so, wie Riemer es sich vorstellt, dann würde das Ergebnis sehr genau zeigen, wie stark der Kopf schon auf die Hypoxie reagiert hat. „Das könnte man in einer Skala von null bis zehn ausdrücken, oder als Ampel: Grün – Gelb – Rot. Bergsteigern könnte man dann eindeutig sagen: Deinem Kopf geht es noch gut; oder: Du steigst besser ab.“
Da sich bei Hypoxie die Gefäße im Kopf ausweiten, erwarte ich, dass man diese Veränderung an der Ausbreitung der Pulswelle erkennen kann.
Kai Riemer
Aber sein Interesse ist nicht die Höhenmedizin. Die Höhe bietet nur die Möglichkeit, die Wirkung des Sauerstoffmangels an Gesunden zu untersuchen; Menschen auf der Intensivstation leiden meist an so vielen Dingen, dass nicht herauszufiltern ist, welche Veränderungen tatsächlich auf die Hypoxie zurückzuführen sind. Doch auch bei Untersuchungen in den Bergen gibt es Störfaktoren – das Wetter, die Anstrengung beim Aufstieg ... Der Extremklimasimulator dagegen erlaubt vollständige Kontrolle: Alle unerwünschten Einflüsse können ausgeschaltet werden. Auf die Idee, am Institut für Alpine Notfallmedizin zu forschen, kam Riemer durch den terraXcube.
Dass das einmalige Labor in der kleinen Hauptstadt einer schönen Bergregion steht, empfand er aber als erfreuliche Beigabe in einem Moment, in dem er sich nach den Jahren in der Metropole wieder mehr Natur wünschte. Er ist in einer grünen Gegend Berlins in der Nähe vieler Seen aufgewachsen und seine gesamte Familie wandert gern. Zweimal im Jahr fuhr man in die Berge. Eine neue Dimension bekam seine Outdoor-Leidenschaft, als er in Großbritannien begann, ambitioniert Landschafts- und Naturfotografie zu betreiben – die Ergebnisse sind auf seiner Webseite und seinem Instagram zu sehen.
In Großbritannien organisierte er auch „so Mini-Abenteuertouren“: etwa in Nordwales innerhalb 24 Stunden auf alle 15 Welsh3000s, die 3.000 Fuß (gut 900 Meter) hohen Berge, zu steigen. „Hier lachen alle drüber, aber es ist eine großartige Landschaft.“ Die Challenge in Wales organisierte er als Fundraising-Event für die British Heart Foundation. In Südtirol hat er etwas Ähnliches für die Bergrettung vor.
Nach London zieht es ihn nicht zurück, obwohl er weiterhin mit Wissenschaftlern des Imperial College zusammenarbeitet – zu hoch sind die Kosten. „Das ist heute generell ein großes Problem: Die Gehälter in der Forschung haben nicht mit der Teuerung Schritt gehalten.“ Dieser „Lebensrealität“ sei auch geschuldet, dass er professionelle Drohnenvideografie anbietet: Das macht ihm großen Spaß und hilft, das kostspielige Hobby Fotografie zu finanzieren. Als junger Forscher muss man findig sein. Oder in die Industrie gehen, sagt Riemer – dann könnte man sich auch London gut leisten. Doch das ist im Moment noch keine Option. Er hat ja ein großes Ziel vor Augen.
Kai Riemer
Kai Riemer ist auf Blutfluss-Bildgebung und Superresolution-Ultraschallbildgebung spezialisiert und forscht derzeit als Marie-Curie-Stipendiat am Institut für Alpine Notfallmedizin von Eurac Research. Davor arbeitete er am Imperial College London, wo er auch promovierte.