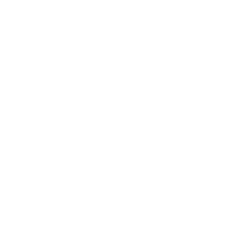magazine_ Interview
Hilft Föderalismus im Kampf gegen die Pandemie?
Francesco Palermo und Carolin Zwilling vergleichen die Erfahrung in Italien und Deutschland
Im föderalen Deutschland entschieden die Bundesländer, Angela Merkel bei der Pandemiebekämpfung die Führungsrolle zu überlassen. Die italienischen Regionen dagegen wurden durch Gesetzesdekrete von oben herab entmachtet.
Wie sich verschiedene Verfassungssysteme in der Coronakrise bislang bewährten, ist eine in Expertenkreisen intensiv erörterte Frage. An der Diskussion beteiligt sind auch Francesco Palermo und Carolin Zwilling. Im Interview sprechen sie über nicht genutzte deutsche Möglichkeiten, erstarkenden italienischen Zentralismus – und darüber, wie Föderalismus Leben retten kann.
Als Europa im Frühling 2020 erstmals mit der Pandemie konfrontiert war: Reagierten Italien und Deutschland da sehr unterschiedlich?
Francesco Palermo: In der Praxis waren die Unterschiede nicht dramatisch: In beiden Ländern hat in dieser ersten Phase, als alle völlig unvorbereitet waren, verständlicherweise die Zentralregierung die Bekämpfung in die Hand genommen, unterstützt durch Fachleute – das Robert-Koch-Institut in Deutschland, das Expertenkomitee in Italien. Das Verfahren aber war ganz anders. In Deutschland wurde zum einen kein Notstand erklärt, und zweitens haben die Bundesländer eindeutig ihre Kompetenzen behalten; sie selbst haben entschieden, die Zuständigkeiten an die Bundesregierung zu delegieren. Dagegen wurden die Regionen in Italien durch Gesetzesdekrete und Verwaltungsakte (die berühmten DPCM) praktisch von oben herab entmachtet. Das ist ein wesentlicher Unterschied, auch wenn die Regionen alle mitgespielt haben – der erste Fall, wo eine Region aus der Reihe tanzte, war das Südtiroler Landesgesetz vom Mai.
In Deutschland war damals in der öffentlichen Debatte das Argument zu hören: Weil noch niemand weiß, was in dieser Situation am besten wirkt, kann es auch nützlich sein, wenn Bundesländer verschiedene Wege auszuprobieren.
Palermo: Im Allgemeinen wurden in Deutschland die Vorteile des föderalen Systems, das flexible Lösungen und regionale Diffenzierung erlaubt, nicht in Frage gestellt; erst in der zweiten Phase gab es hie und da Kritik an dem „Flickenteppich“ an Vorschriften. In Italien hingegen eröffneten die Medien sofort eine Diskussion darüber, ob es sinnvoll sei, 21 regionale Gesundheitssysteme zu haben – meist mit dem Schluss, dies mache keinen Sinn, sei ganz unmöglich, usw. Also in Italien war die Mehrheit eher gegen eine differenzierte Lösung, obwohl sich gerade hier das Virus regional ganz unterschiedlich ausbreitete.
Carolin Zwilling: Ein Aspekt, der in Deutschland kritisiert wurde, war die mangelnde Transparenz, mit der die Entscheidungen gefällt wurden, denn die Ministerpräsidentenkonferenz, wo die Regierungschefs der Länder die Bundeskanzlerin treffen, findet hinter verschlossenen Türen statt. Und wie in Italien auch beobachtete man eine Verschiebung hin zur Exekutive: Die Parlamente, auch auf regionaler Ebene, spielten keine große Rolle.
Was war in der zweiten Welle anders?
Zwilling: In Italien hat man begonnen, die Regionen mehr einzubeziehen, jedenfalls insoweit, dass Informationen fließen, man miteinander spricht. Das heißt nicht, dass sie wirkliche Mitentscheidungskompetenz haben, dafür gibt es in Italien auch gar keinen Ort: In der Ständigen Konferenz, wo Staat, Regionen und autonome Provinzen sich treffen, wird nicht auf Augenhöhe miteinander geredet oder gar mitentschieden. Auch über das im Herbst eingeführte Ampelsystem bestimmt die Zentralregierung. Als die Lombardei sich gegen ihre Farbeinstufung wehren wollte, kam sie nicht weit.
Palermo: Ja, es ist die staatliche Rechtsquelle, die die Differenzierung erlaubt hat – also rechtlich hat sich nichts geändert. Inhaltlich aber schon: Die Treffen der Ständigen Konferenz, die in der ersten Panik fast ausgesetzt waren, finden wieder regelmäßig statt, die Maßnahmen werden besprochen, die Regionen haben, wenn auch nicht rechtlich, so doch politisch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Eigentlich ist es paradox: Als die Situation in den verschiedenen Regionen sehr unterschiedlich war, wurden allen einheitliche Maßnahmen aufgezwungen, seit das Infektionsgeschehen sehr viel einheitlicher ist, erlaubt man eher maßgeschneiderte Lösungen für jede Region.
Zwilling: Deutschland sah in der zweiten Welle viel zentralistischer aus, als es eigentlich ist, denn die Bundesländer haben durchgängig gemeinsame Entscheidungen getroffen. Sie hätten ja auch Konkurrenz schaffen können: Wer geht am besten gegen die Pandemie vor? Besonders gut funktionierende Lösungen hätten dann von anderen als lehrrreiches Beispiel übernommen werden können. Das ist so nicht passiert. Man hat sich für Einheitlichkeit entschieden, auch einfach aus Gründen der Effizienz: Bundesbürger an den Bundesländergrenzen aufzuhalten, so wie in Italien die Grenzen zwischen Regionen geschlossen wurden – das wäre in Deutschland glaube ich nicht durchsetzbar gewesen, das hätte zu einer kleinen Revolte geführt. Also auch der Kulturfaktor, der mit dem föderalen System verbunden ist, spielt eine wichtige Rolle, gerade wenn es um so etwas Persönliches wie Gesundheit geht.
Was bewährt sich in Ihren Augen in solchen Krisen besser: Föderale Systeme oder ein starker Zentralstaat?
Zwilling: Da ist wieder zwischen Theorie und Praxis zu unterscheiden: Theoretisch denke ich wäre Föderalismus von Vorteil, aber die Frage ist, ob man seine Möglichkeiten auch nutzt. Was man in Deutschland wie gesagt eben nicht tat. Übrigens auch in der Schweiz nicht: Da hat die Zentralregierung den Kantonen die Entscheidungen überlassen, wie sie die Pandemie bekämpfen wollen, diese haben die Gelegenheit aber nicht richtig ergriffen und die Folge war, dass die zweite Welle dort sehr viel extremer ausfiel.
Palermo: Ganz plakativ würde ich den großen Vorteil föderaler Systeme so darstellen: Man hat eine Wahl. Die Gliedstaaten können entscheiden, was sie an die Bundesregierung delegieren wollen und was nicht. Darin liegt eine Chance. Denn es kann sein, dass die Zentralregierung es besser macht, als die Bundesstaaten – es kann aber auch umgekehrt sein. Nehmen wir das Beispiel USA, oder auch Brasilien: Da wurden in dieser Pandemie dank des föderalen Systems viele Leben gerettet, weil Gliedstaaten der Zentralregierung nicht gefolgt sind und Maskenpflicht einführten.
Natürlich kann keine Region allein eine Pandemie bekämpfen, das können ja nicht einmal Staaten allein, darum geht es nicht. Worum es geht ist: Wie gelangt man zu maßgeschneiderten Lösungen? Und gerade in Italien hat sich ja gezeigt, dass die Auswirkungen einer Pandemie in den Regionen ganz unterschiedlich sein können.
Könnte die Erfahrung Covid-19 also in Italien den Regionalismus voranbringen?
Palermo: Ich befürchte, die Entwicklung geht in die Gegenrichtung. Die Mehrheit – in der Politik sowieso, aber auch in der Lehre – ist sehr dafür, den Regionen die Gesundheitskompetenzen ganz wegzunehmen oder sie zumindest stark zu beschneiden. Nur ein Beispiel: Als der Verfassungsgerichtshof vor kurzem das Regionalgesetz des Aostatales zur Pandemiebekämpfung aufhob, weil es dem Staat und nicht den Regionen zustehe, die nötigen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung festzulegen, wurde in der Whatsapp-Gruppe der Verfassungsrechtler regelrecht gejubelt: Endlich Schluss mit dem regionalen Unfug. Und das auch von Leuten, deren Regionen die Pandemie besser gemanagt haben als der Staat selbst!