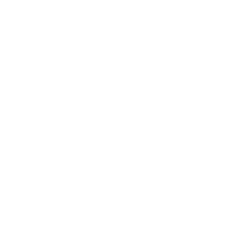magazine_ Interview
Schön cool!
Ingenieurin Alexandra Troi (Eurac Research) und Kunsttheoretiker Stephan Schmidt-Wulffen (unibz) tauschen sich über den Begriff "Schönheit" aus.
Warum nur tun wir uns heute mit dem Begriff "Schönheit" so schwer? Academia spricht mit dem Kunsttheoretiker Stephan Schmidt-Wulffen (unibz) und der Ingenieurin Alexandra Troi (Eurac Research).
Professor Schmidt-Wulffen, wie wichtig ist Schönheit für Sie persönlich?
Stephan Schmidt-Wulffen: In der Kunst und im Design ist der Begriff ziemlich aus der Mode gekommen. „Schönheit“ war immer mit einem idealistischen Verständnis verbunden, war im Grunde göttliches Maß. Und die moderne Kunst hat es sich in den vergangenen 100 Jahren zur Aufgabe gemacht, diese normative Schönheit in Frage zu stellen. Gegen das Idealmaß hat man die Zufälligkeit des Alltags ausgespielt – denken Sie nur an die Dadaisten. Auch im Design ist Schönheit nicht mehr wichtig. Wir reden heute vielmehr von Nachhaltigkeit, von Sinnhaftigkeit, von Handlung und Funktionen. Ob etwas schön aussieht, ist kein Kriterium mehr, weil es nicht mehr an einer vorgegebenen Norm zu messen ist.
Alexandra Troi: Ich denke, teilweise haben wir heute aber auch nur andere Begriffe, um Schönheit zu beschreiben. Mir fällt dazu mein Sohn ein, mit dem ich kürzlich in Rotterdam war. Wir kommen aus der Metrostation heraus und blicken auf die riesige, grellbunte Markthalle und die berühmtenschräggestellten Kubushäuser und Samuel meint: Ist das eine coole Stadt!
Also ist cool das neue Schön?
Schmidt-Wulffen: Ja, cool entspricht aber auch einem Habitus. Es ist keine Qualität mehr. Von dem Wort „schön“ erwarten wir ja eine essentielle Qualität, über die man nicht mehr streiten kann. Das ist abhandengekommen. Wir suchen uns Objekte, die unserer Lebensform entsprechen, sie eleganter, schicker, effektiver, zeitgemäßer machen.
Troi: Interessant ist hier auch, die Denkmalpflege zu nennen, die schließlich das „Schöne“ erhalten soll. Was aber ist für die Denkmalpfleger schön, also erhaltenswert? Fragt man sie, so ist es das Material, wie es verarbeitet wurde, wie es sich manifestiert.
Schmidt-Wulffen: „Schön“ ist in der Denkmalpflege ja etwas Bedrohliches. Was für viele Leute sehr schön ist, geht immer in Richtung Walt Disney. Dagegen müssen die Denkmalpfleger oft ankämpfen, die das Altern der Objekte sichtbar halten wollen. Hier treffen wir auf das soziologische Problem einer Schönheit, die im Stereotyp und in der Idylle erstarrt ist.
Troi: Ich glaube, dass das Thema Vermittlung eine große Rolle spielt. Als ich als Technikerin das erste Mal durch das jahrelang ungenutzte Waaghaus in Bozen gegangen bin, habe ich gedacht: Hilfe, in welchem Zustand ist dieses Gebäude? Meine Mitarbeiterin, eine Denkmalpflegerin und Architektin, hat dagegen neben all den Schäden die kleinen wertvollen Details gesehen und sie mir vermittelt. Das braucht es, damit ich als Technikerin bei Eingriffen erhalten kann, was das Gebäude in Wert setzt. Deshalb spiegelt sich eine gute Zusammenarbeit von Technikern und Künstlern oder Architekten immer unmittelbar in der Qualität von Bauten wider.
Es ist nicht alleine eine Frage des Geldes. Es ist eine Frage, ob man in Denken und Gestalten investiert.
Alexandra Troi
Bei vielen Klimahäusern scheinen aber vor allem die Techniker das Sagen zu haben.
Troi: Das muss nicht so sein. Mein Appell an die Architekten und Künstler ist, das Klimahaus zu gestalten. Und es gibt gute Beispiele, wo Architekten gestaltend mitwirken und dann wird das energieeffiziente Gebäude auch ein schönes Beispiel für Architektur.
Schmidt-Wulffen: Hier kommt ein wichtiger Aspekt ins Spiel, den man nicht übersehen darf. Als man die Schlösser des 18. Jahrhunderts gebaut hat, gab es keinen Unternehmer, der die Quadratmeterkosten berechnet hat. Die Rendite, die ein Bauwerk dagegen heute bringen muss, schränkt die Spielräume für das, was wir schön nennen, drastisch ein. Die von Frau Troi erwähnten Bauwerke in Rotterdam sind Sonderfälle, wo ein Unternehmen es sich leistet, so einen Leuchtturm zu bauen. Wenn man dagegen ein Klimahaus baut, dann gibt es eine Deckelung, da ist es Schluss mit lustig und Schluss mit schön.
Troi: Ich glaube, es ist nicht alleine eine Frage des Geldes. Es ist eine Frage, ob man in Denken und Gestalten investiert. Und das muss nicht immer teurer sein. Auch nicht teurer als einfach nur den Standard durchzuziehen, ohne zu überlegen.
Schmidt-Wulffen: Ein Beispiel dafür ist die Architekturschule in Nantes. Dort konnten die Architekten Lacaton-Vassal das Raumvolumen verdoppeln – durch eine einfache Ständerarchitektur, die mit flexiblen Wänden immer wieder anders genutzt werden kann. Das ist vielleicht nicht ‚schön’, aber sehr intelligent. Auch das ist ein Kriterium für das, was aus Schönheit geworden ist. Ein solches Gebäude kitzelt das Gehirn: Plötzlich den Raum für den Nutzer anders gedacht zu sehen.
Doch wenn wir Sie richtig verstehen, kann die Schönheit historischer Gebäude heute auch mit Energieeffizienz Hand in Hand gehen, Frau Professor Troi?
Troi: Ja, ich kann historische Gebäude werterhaltend, energieeffizient und behaglich machen. Wir können solche Gebäude schließlich nur erhalten, wenn wir sie weiterhin nutzen. Ich kann ja nicht alles zu Museen umgestalten. Wir haben einmal eine Rechnung aufgestellt, laut der rund 120 Millionen Europäer in alten Gebäuden leben. Und die meisten leben gerne dort, und suchen Lösungen, wie sie nachhaltig genutzt werden können. Und natürlich braucht es hierfür die entsprechenden finanziellen Mittel.
Fällt Ihnen dazu ein Beispiel ein, wo dies besonders gut gelungen ist?
Troi: Bei ländlich historischen Höfen wie dem Rainhof in Gsies, dem Huberhof in Rodeneck oder dem Aussergrubhof im Ultental. Besonders gelungen ist auch die Sanierung eines denkmalgeschützten Hauses am Como See. Dort hat der Besitzer gesagt: Ich möchte jetzt investieren, damit meine Kinder das Haus später nicht verkaufen müssen, weil sie die Heizung nicht zahlen können. Und langfristig gesehen lohnt sich so eine Investition ganz klar, schwierig wird es nur, wenn wir immer in kurzfristigen Zeiträumen denken und planen.
Schmidt-Wulffen: Es gibt aber auch ganz andere Realitäten wie die ländliche Kultur, wo der Verfall der Tradition die Geschmacksalternativen gar nicht zuließ. Dort renoviert jeder nach seinem Gusto und kein Bürgermeister und kein Denkmalsschützer kommt und sagt: Ihr könnt doch nicht eure steiermärkischen Häuser in kanariengelb und lindgrün anmalen.
Troi: Doch zumindest in einigen Gemeinden werden Restaurierungsprozesse auch gestaltet. In Truden zum Beispiel, einer kleinen Gemeinde, von Abwanderung bedroht, gab die Gemeindeverwaltung den Bürgern die Möglichkeit, ihre Häuser auf eine Art umzugestalten, die ihren Vorstellungen entspricht, aber gleichzeitig den Charakter des Dorfes erhält. Dort wurde eine gezielte Bauberatung mit einem sehr engagierten Architekten initiiert, und das Ergebnis lässt sich wirklich sehen.
Plötzlich den Raum für den Nutzer anders gedacht zu sehen. Ein solches Gebäude kitzelt das Gehirn.
Stephan Schmidt-Wulffen
Schmidt-Wulffen: Vorarlberg ist auch so ein Beispiel, wo man es geschafft hat, die Kultur früherer Generationen als kulturelles Erbe zu pflegen. Ich glaube, das ist wirklich das Thema unserer Zeit: Nicht einfach zu sagen, ist das schön oder ist das nicht schön, sondern: Wie können wir ein Bewusstsein schaffen für den Sinn kultureller Formen oder den Wert alter Bautechnologien.