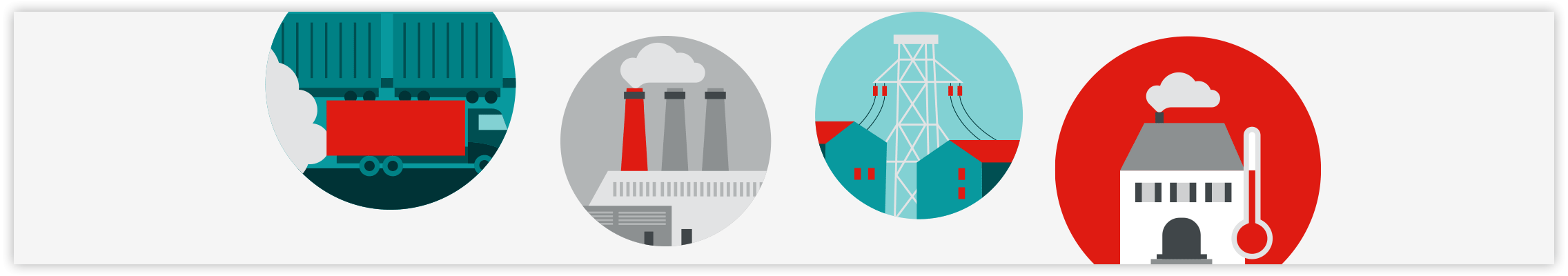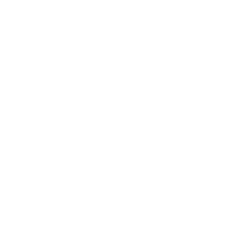magazine_ Article
Natur gerecht
Lassen sich mit Hilfe der Natur einige der drängendsten urbanen Probleme lösen?
Ein Flecken Grün, ein Stück Gerechtigkeit: Durch Gemeinschaftsgärten kommen auch Menschen in benachteiligten Stadtteilen in den Genuss von Natur und aller damit verbundenen Vorteile. Den 103rd Street Community Garden in East Harlem, New York, haben die Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels mitgeplant und mit wenig Geld und viel Freiwilligenarbeit verwirklicht.
Fassadengrün und Dachgärten, um Betonwüsten zu kühlen, Feuchtgebiete als Wasserauffangbecken, Mooswände, die Feinstaub binden, und überall mehr Lebensräume für Tiere und Pflanzen: Weltweit reagieren Städte mit sogenannten naturbasierten Lösungen auf Klimawandel und Biodiversitätsverlust. Ein großes europäisches Forschungsprojekt entwickelt Wege, das Potenzial besser auszuschöpfen. Mit einem ehrgeizigen Ziel sozialer Natur: Die Vorteile sollen vor allem bisher Benachteiligten zugutekommen.
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Luft einflussreiche Menschen atmen? Wie die Stadtviertel aussehen, in denen sie leben – sind da Gärten mit altem Baumbestand und Vogelgezwitscher am Morgen? – und wie ihre Wochenenden: Entspannen sie an einem Zweitwohnsitz in idyllischer Landschaft? Nein? Nach einem Gespräch mit der Biologin und Raumplanungsexpertin Sonja Gantioler stellt man sich solche Fragen. Und weiter: Wie oft machen diese Menschen, die vielbefahrene Straßen hauptsächlich vom Auto aus erleben, eine Flugreise? Wie gelangen sie an ihren Zweitwohnsitz?
Und schon hat man in aller Schärfe eine „Diskrepanz“ (Gantioler) vor Augen, die unsere Städte leider ebenso charakterisiert wie den Globus insgesamt: Wer mit seinem Lebensstil viele Emissionen verschuldet, gehört im Allgemeinen nicht zur Gruppe Menschen, die die Folgen davon besonders schmerzhaft zu spüren bekommt, hat aber in stadtplanerischen oder umweltpolitischen Entscheidungsprozessen relativ viel Gewicht. Dass das nicht gerecht ist, liegt auf der Hand.
Gerechtigkeit – bezogen auf die Verteilung von Umweltgütern – ist ein zentrales Thema in der Forschungsarbeit von Sonja Gantioler. Neben Biologie hat sie Umweltökonomie und Politik studiert, und ihre Dissertation analysiert, wie ein gerechter Zugang zu ökologischem Raum in der Stadt garantiert werden kann. Nun bringt die Forscherin ihr Interesse an ökologischen und sozialen Systemen gerade in ein neues, großes EU-Projekt ein: In sieben europäischen Städten wird man im Laufe der nächsten fünf Jahre „naturbasierte Lösungen“ umsetzen – ein Sammelbegriff für eine große Bandbreite an Maßnahmen, die mit Hilfe der Natur gesellschaftlichen Herausforderungen begegnen – und zwar möglichst in einer Weise, die bisherigen sozialen Ungleichgewichten entgegenwirkt.
Die Natur performt nicht.
Sonja Gantioler
In den allgemeinsten Begriffen ausgedrückt sollen nature-based solutions, wie der englische Fachbegriff heißt, helfen, uns dem Klimawandel anzupassen bzw. uns vor seinen Auswirkungen zu schützen, Emissionen zu reduzieren, die Biodiversität zu fördern und menschliches Wohlbefinden zu verbessern. Im Konkreten zeigen Beispiele auf der ganzen Welt eine eindrucksvolle Leistungspalette. Durch Aufforstung und den Erhalt von Wäldern etwa kann Erosion vermieden und Kohlenstoff gebunden werden: Im Becken des Poyang-Sees, des größten Süßwassersees Chinas, haben solche Maßnahmen die Bodenerosion in den vergangenen 25 Jahren um die Hälfte reduziert, gleichzeitig die Kohlenstoffbindung um das Fünffache und das Nettoeinkommen der Bauern um das Sechsfache erhöht. An Küsten werden Ökosysteme wie Korallenriffe, Seegraswiesen und Mangroven zum Schutz vor Extremwetterereignissen und dem steigenden Meeresspiegel eingesetzt, mit erwiesenem Nutzen, wie Studien zeigen.
In Städten sollen naturbasierte Lösungen vor allem gegen die zunehmend akuten Probleme Hitzeinseln, Überflutungen nach Starkregen, Luftverschmutzung und schwindende Biodiversität wirken. Dabei ist, je nach Ort und Umständen, meist ein Ziel vorrangig, alle Maßnahmen haben jedoch eine wunderbare Gemeinsamkeit: Sie lösen nie nur ein Problem. So sorgen zum Beispiel Grünflächen und bepflanzte Fassaden oder Dächer durch Beschattung und Evaporation für Abkühlung, zugleich aber speichern sie bei Starkregen Wasser und geben es verzögert wieder ab – das Konzept der „Schwammstadt“ war nach den Überflutungen in Deutschland vergangenen Sommer in aller Mund; sie sind Lebensraum für Vögel, Kleintiere und Insekten, fördern also die Biodiversität; ihre Blätter binden Feinstaub und Stickstoffoxide; auf grünen Dächern ist Platz für Bienenstöcke (so in Bozen auf dem Dach der Messe) oder Gemüsegärten; an strategischen Stellen angelegt, können Grünflächen langsameres Autofahren erzwingen; und schließlich: Durch grünere Straßen geht man lieber zu Fuß oder fährt mit dem Rad, was neben der Umwelt auch der Gesundheit zugutekommt. (Und die Kaskade positiver Wirkungen könnte man weiterverfolgen, von der essentiellen Wichtigkeit der Bienen, zu den Vorteilen selbstgezogenen Gemüses und der Entspannung des Hobbygärtners. . . ). „Es geht bei diesen Lösungen nicht darum, eine Funktion zu maximieren: So funktionieren sie nicht und da können und sollen sie auch nicht mit technischen Lösungen konkurrieren. Es ist die enorme Vielfältigkeit, die ihre Stärke ausmacht“, erklärt Gantioler. Sie hat ein Problem damit, dass in Projektanträgen immer „Key Performance Indicators“ genannt werden müssen: „Die Natur performt nicht.“
Wieviel ist es wert, wenn Kinder auf einer Brache im Gebüsch spielen können?
Was in den sieben Projektstädten genau passieren soll, ist jetzt, zu Beginn, noch Großteils offen. Alles andere wäre auch gegen die Philosophie des Vorhabens, denn es soll ja gerecht zugehen, und da ist ein grundlegender Punkt: Wem wird überhaupt ein Mitspracherecht zuerkannt? Wer wird gefragt, was die Bedürfnisse sind? „Die Menschen, die einen Ort leben und sich täglich damit auseinandersetzen, sind auch Experten. Und diese Expertise gilt es einzubeziehen.“ Die Herausforderung sei, sagt Gantioler, Partizipationsprozesse so zu gestalten, dass nicht immer die gleichen Gruppen und Generationen mitbestimmen. Man also auch den Einfluss jener ausbalanciert, die keine hohe Feinstaubkonzentration vor dem Gartentor und deshalb in diesem Punkt vielleicht eine verzerrte Wahrnehmung haben. „Da muss man sich auch Machtdynamiken anschauen, Strukturen aufbrechen – oder sagen wir besser: zumindest damit anzufangen“, sie lacht: „Das ist ja eine Mammutaufgabe. Eine Vision des Projekts.“ Nach einer Vorzeigestadt in diesem Sinne gefragt, nennt sie New York: „Dort wurde eine Plattform geschaffen, um Brachflächen zu identifizieren, und über diese Plattform konnten sich dann auch Menschen zusammenfinden, um die Flächen zu gestalten. Da sind dann zum Beispiel Gemeinschaftsgärten entstanden, oder auch einfach Plätze, wo Kinder frei spielen konnten.“
Wie den Wert solcher Lösungen beziffern? Obwohl Experten mittlerweile eine gewisse Übung darin haben, die Leistungen, die Ökosysteme für uns erbringen, in Geld auszudrücken, gibt es in einigen Aspekten noch Unsicherheit – mit welcher Summe schlägt es beispielsweise zu Buche, wenn Kinder auf einer städtischen Brache im Gebüsch Hütten bauen können, anstatt vor der Playstation zu sitzen? Auch der Zeitfaktor spielt eine Rolle, denn naturbasierte Lösungen entfalten ihre volle Wirkung oft relativ lange nach dem Zeitpunkt, zu dem die Kosten anfallen. Eine Studie kam deshalb zu dem Schluss, der Nutzen naturbasierter Lösungen werde in Analysen systematisch unterbewertet, was Investitionen natürlich hemmt.
Trotzdem herrscht Einigkeit, dass diese Lösungen, gesamtgesellschaftlich betrachtet, sehr kosteneffektiv sind, man mit vergleichsweise geringem finanziellem Aufwand viel erreicht. Und auch für Private zahlt es sich aus, beispielsweise in grüne Fassaden und Dächer zu investieren: Die Kosten für Kühlung reduzieren sich, die Gefahr von Überflutungen schwindet, und aktuelle Untersuchungen haben gezeigt, dass PV-Anlagen auf begrünten Dächern deutlich effizienter sind. Dennoch zögen private Investoren häufig technologische Lösungen vor, erklärt Gantioler, weil die Kosten überschaubarer scheinen, während Lösungen, die auf Ökosysteme setzen, einen unkalkulierbaren Aufwand für Erhalt und Pflege befürchten lassen. „Oft herrscht da aber auch eine zu gärtnerische Vorstellungen davon, wie sehr man etwas ständig bearbeiten muss – manchmal darf man Dinge auch einfach in Ruhe lassen.“ Nicht der Park mit gestutzten Hecken ist unbedingt anzustreben: Gerade informelle Flächen, wo wachsen darf was eben wächst, sind Hotspots der Biodiversität.
Eine Gefahr ist, dass Dekarbonisierung in den Hintergrund rückt. Eine andere: grüne Gentrifizierung.
Werden solche Flächen verbaut, dann ist der Verlust nicht einfach damit aufzuwiegen, dass man dem neuen Gebäude ein grünes Dach und eine Efeufassade verpasst (obwohl dies einem reinen Glas-Beton-Palast natürlich vorzuziehen ist). „Das liefert nicht die gleichen Funktionen“, sagt Gantioler. Es bestehe die Gefahr, dass naturbasierte Lösungen als Ausgleichsmaßnahme end of pipe auf Bauprojekte draufgesetzt würden, weil dies einfacher erscheint, als darüber nachzudenken, wie man bestehende natürliche Strukturen erhalten und integrieren könne. Noch eine andere Gefahr sehen Fachleute: Dass der Enthusiasmus für naturbasierte Lösungen von der dringenden Dekarbonisierung ablenkt. Das war auch eine zentrale Kritik an der Mooswand, die man am Stuttgarter Neckartor testete, um eine der höchsten Feinstaubbelastungen Deutschland zu senken: Man habe Geld für ein grünes Pflaster ausgegeben, anstatt die autogerechte Stadt in Frage zu stellen. (Das Moos, zu sehr der Sonne ausgesetzt, kämpfte ums Überleben; in der Luft konnte kein quantitativer Effekt festgestellt werden.)
„Das Problem ist so komplex, da kann es nicht nur eine Lösung geben. Man muss viele Hebel ansetzen“ sagt Gantioler. Einer davon kann auch sein, die Natur zu kopieren: etwa Materialien zu verwenden, die, wie die Oberflächen vieler Pflanzen, die Sonneneinstrahlung in hohem Grad reflektieren. Ob man dies noch „naturbasiert“ nennen will, hängt davon ab, wie eng man die Definition begreift. Manche Aspekte menschlichen Wohlbefindens können solche nachahmenden Lösungen jedoch nicht verbessern. Gerade in benachteiligten Stadtvierteln, zeigten Studien, schafft „Natur“ ein stärkeres Gefühl der Identifikation und Zugehörigkeit, Gemeinschaft. Die gleichen Maßnahmen können je nach Rahmenbedingungen aber auch ganz anders wirken: In den USA haben Viertel, in denen in Private-Public-Partnership Parks angelegt oder Bäume gepflanzt wurden, eine Gentrifizierung erfahren – die Häuserpreise stiegen, niedrigere Einkommensschichten sahen sich ausgegrenzt. Die Städte wurden grüner, aber noch ungerechter.
Weiterführende Informationen zum Projekt: https://cordis.europa.eu/project/id/101003757