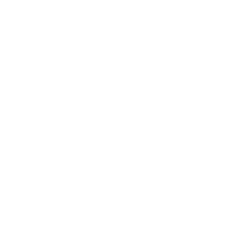Design kann mehr als schöne Stühle

Sabine Junginger, Professorin für Design und Management an der Hochschule Luzern, spricht über Design in der öffentlichen Verwaltung, warum es wichtig ist, dumme Fragen zu stellen und über ihren amtlich konstatierten abnormalen Lebenslauf.
Am 10. März ist sie in Bozen zu Gast - und zwar beim Workshop “Fit for the Future with Design”, zu dem das Center for Advanced Studies von Eurac Research und die Fakultät für Design und Künste der Freien Universität Bozen laden.
Eurac Research: Frau Junginger, fragt man unterschiedliche Personen, was sie mit Design verbinden, so reichen die Antworten von teuren Wohnzimmermöbeln bis hin zur Innengestaltung von Linienbussen. Was kann Design denn noch?
Sabine Junginger: Ich beschäftige mich mit Human-Centred Design. Dieser humanistische Design-Ansatz geht davon aus, dass es zum Wesen des Menschen gehört, zu gestalten. Egal, ob in der Höhle oder im industriellen Zeitalter – Menschen haben ihre Umwelt, ihre Mitwelt immer schon gestaltet. Die Fragen bleiben bis heute dieselben: Wie leben wir? Wie wollen wir leben? Und wie kommen wir dahin? Bei all den Krisen, Stichwort Klimakrise, sind wir auch gezwungen, zu gestalten oder umzugestalten. Im Design geht es in erster Linie darum, dass jemand eine Idee hat, wie irgendetwas, das es bis dahin noch nicht gab, entstehen könnte. Die Harbour Bridge in Sydney oder das Wohnzimmermöbel, das Sie erwähnt haben, sind deshalb genauso Design, wie es Organisationen, Dienstleistungen oder politische Initiativen sind. Sie alle sind Resultate gestalterischen Denkens und Handelns. Menschen haben sich Gedanken gemacht, Kriterien ermittelt und Materialien entdeckt, erfunden oder genutzt, um diesen Gedanken Form zu geben und sie materiell oder – wie im Falle von Dienstleistungen – auch immateriell umzusetzen.
Die öffentliche Verwaltung ist nicht gerade für ihren Innovationsgeist oder ihre Flexibilität bekannt. Ein falscher Eindruck? In genau dem Bereich sind ja viele Ihrer Projekte angesiedelt.
Junginger: Das Interessante in der öffentlichen Verwaltung ist, dass wir dort sehr genau wissen, wer designt, also wer gestaltet, obwohl sich die dort Arbeitenden wohl nicht unbedingt als Designerinnen oder Designer sehen würden. Dabei haben sie vielleicht gerade erst ein neues Formular entworfen oder eine Dienstleistung eingeführt, die es bislang noch nicht gab. Als Forschende interessiert uns, welche Gestaltungsoptionen bereits bekannt sind und angewendet werden. Da stellt sich oft heraus, dass vor allem im Management nur bestimmte gestalterische Handlungen und Denkweisen unterstützt werden. Lange Zeit hat man in dem Bereich nach dem Ausstecherle-Prinzip gearbeitet.
Das müssen Sie bitte genauer erklären.
Junginger: Nun, da kam etwa ein Management-Guru mit dem Versprechen: „Wenn ihr diese Organisation ändern wollt, dann müsst ihr A, B, C, D, E machen“. Und dann hat man A, B, C, D, E gemacht – und sich anschließend gewundert, warum es nichts gebracht hat. Wir haben immer eine einzigartige Organisation vor uns, und es bringt überhaupt nichts, wenn ich da reingehe und einen großen Design-Thinking-Workshop mache. Wenn wir mit Organisationen zusammenarbeiten, dann müssen wir sicherstellen, dass die Menschen, die dort tätig sind, die Design-Methoden selbst erlernen und für sich adaptieren. Dass man da nicht an einem Montag anfängt und am Freitag in zwei Wochen fertig ist, versteht sich von selbst. Wir haben es schließlich mit Wandel zu tun. Mit kulturellem Wandel. Mit strukturellem Wandel. Mit Verhalten. Das ist ein langwieriger Prozess, den wir aus Designperspektive gut unterstützen können. Wir sind etwa die offiziellen Partner für die digitale Transformation der Gemeinde Emmen im Kanton Luzern. Diese Zusammenarbeit läuft bereits seit mehreren Jahren.
Meistens kommen die Leute dann zum Design, wenn sie gar nicht mehr weiterkommen. Dann heißt es: „Jetzt gehen wir mal zu den crazy Designern. Die kriegen das hin.“
Sabine Junginger
Menschen dazu zu bewegen, ihre Lebensweise zu verändern, ist schwer und langwierig. Organisationsstrukturen in Institutionen zu verändern ebenso. Wo sehen Sie die größte Hürde, wenn es darum geht, Ansätze aus dem Design in öffentlicher Verwaltung oder auf Managementebene anzuwenden?
Junginger: Die größten Hürden sind ganz klar Berührungsängste. Das mag jetzt nach einem Stereotyp klingen, aber gerade in der Verwaltung, insbesondere im deutschsprachigen Raum, gibt es zu wenig positive Fehlerkultur. Es herrscht die ständige Furcht, Fehler zu machen, was auch damit zusammenhängt, dass Menschen darauf trainiert sind, ihre Position und ihre Rolle in einer Organisation bestätigen zu müssen und sich nur keine Blöße zu geben. Als Designerin ist es das Erste, was man macht. Man traut sich, dumme Fragen zu stellen. Ein Fragen, das in vielen Institutionen abhandengekommen ist, weil man vieles entweder als selbstverständlich hinnimmt oder aber, weil man nicht den Mut hat, etwas zu hinterfragen, weil es ja gleichzeitig darauf hindeuten könnte, dass man etwas nicht weiß. Es ist keine einfache Aufgabe, Menschen dazu zu ermutigen, neue Ideen auszuprobieren und zu experimentieren, ohne es als Spinnerei abzutun.
Ist Spinnerei nicht der beste Start für eine Ideensammlung?
Junginger: Den Eindruck, dass Design eine Spinnerei ist, möchte ich nicht vermitteln, denn es wird allzu oft so wahrgenommen. Meistens kommen die Leute dann zum Design, wenn sie ein Problem vor sich haben, bei dem sie gar nicht mehr weiterkommen. Dann heißt es: „Jetzt gehen wir mal zu den crazy Designern. Die kriegen das hin.“ Natürlich erlaubt sich Design Spinnereien, um überhaupt auf neue Gedanken zu kommen, die in einem anderen Rahmen nicht möglich gewesen wären. Der erste Entwurf ist vielleicht ein bisschen schräg, ja. Aber wenn man diese Ideen abklopft, dann bleibt eventuell ein Kern, der wieder zum nächsten Ziel führen kann. Design schafft Grauzonen, in denen mehrere Richtungen offen sind. Wichtig ist, dass man an jedem neuen Knotenpunkt Entscheidungskriterien für den einen oder anderen Weg festlegt. Am Ende eines Designprozesses weiß man dadurch nicht nur, dass man an ein Ziel gelangt ist, sondern hat auch klar vor Augen, wie man dorthin gekommen ist. In meiner Forschung erlebe ich oft, dass ein Produkt eben nicht das Ergebnis bringt, wofür es eigentlich erdacht wurde. Dann muss man den Prozess von hinten aufrollen und in die Hinterfragung gehen. Was haben wir übersehen? Haben wir das Problem falsch erkannt? Haben wir das falsche Material verwendet? Haben wir an der Zielgruppe vorbei gestaltet?
Dass an der Zielgruppe insbesondere an den Bürgerinnen und Bürgern vorbei geplant wird, ist ein Kritikpunkt, der in Governance und Management nicht selten vorkommt.
Junginger: Wenn man nur aus seinem eigenen Denken, der eigenen Lebenswelt und organisatorischen Kenntnis heraus gestaltet, kann das gut gehen oder eben auch nicht. Mit meinen Studierenden hatte ich vor einigen Jahren ein Projekt mit einer Agentur für Arbeit. Dort wurde sehr schnell sehr deutlich, dass sich die Lebenswelt der Menschen, die dazu ausgebildet sind, andere zu beraten und ins Berufsleben einzuführen, sehr von der Lebenswelt ihrer Klientel unterscheidet. Ich habe mir den Spaß erlaubt, bei der akademischen Beratung vorbeizuschauen, um dort zu erfahren, dass ich wohl einen abnormalen Lebenslauf hätte.
Haben Sie sich das begründen lassen?
Junginger: Nein, das habe ich dann doch nicht weiterverfolgt. Die Beraterin hatte aber selbst keine Erfahrung in Bezug auf die Arbeitsbedingungen im akademischen Bereich und ihr war nicht klar, wie prekär die Arbeitssituationen oft sind. Akademikerinnen müssen von einem Projekt zum anderen springen, und ihre Verträge sind meist an die Dauer dieser Projekte gekoppelt. Zwar waren die Beratenden der Agentur sehr gut darin, innerhalb weniger Minuten eine angenehme Atmosphäre für die Jobsuchenden zu schaffen. In dieser kurzen Zeit wurden unglaublich viele Informationen ausgetauscht. Doch dann wurde ein Bildschirm hochgefahren, es folgte ein Protokoll, das abgearbeitet werden musste und schon war es aus mit dem Informationsfluss. Das ist ein klassisches Beispiel für sogenanntes deterministisches Design mit klar vorgegebenem Prozess und wenig Möglichkeiten, irgendwo abzubiegen. Die Studierenden haben deshalb Ideen für emergierendes Design entwickelt, also Design das ergebnisoffen ist, es den Jobsuchenden ermöglicht, ihre Anliegen besser zu äußern - den Beraterinnen und Beratern, das Gespräch weiterzuführen, mittels Whiteboard oder Cloud Technologie die Stärken und Interessen aufzufangen und ihr Fachwissen einzubringen.
Sie selbst haben zunächst im Journalismus und in der Unternehmenskommunikation gearbeitet. Wie kam der Wechsel zum Design?
Junginger: Ich war schon immer sehr designaffin und wollte ursprünglich Modedesign studieren, habe mir das dann aber doch nicht zugetraut. Ich bin dann im Journalismus gelandet. Wenn ich in einem Text etwas vermitteln will, muss ich mir zunächst die Mühe machen, zu verstehen, worum es geht. Diese investigative Arbeit kommt mir auch im Design zugute. Während meines Studiums in Deutschland war ich zunächst als Werkstudentin, dann als freie Mitarbeiterin bei Siemens tätig und hatte die Möglichkeit, im Team von Herbert Schultes (ehemaliger Chefdesigner von Siemens und einer der renommiertesten Industriedesigner Europas, Anm. d. Red.) mitzuarbeiten. Wir waren damals die ersten, die Corporate Guidelines, also die Richtlinien zur Präsentation einer Marke, auf eine CD-ROM gebracht haben. Die gab es zuvor nur in fetten Ringmappen auf den Schreibtischen des Managements – also nicht dort, wo sie etwas nützen würden. Meine Arbeit drehte sich dabei um User Testing und User Research, also darum, dass diese CD-ROM von jenen gelesen werden konnte, die damit arbeiten sollten. In dieser Zeit haben wir außerdem viel damit experimentiert, was das Internet für ein Unternehmen wie Siemens bedeuten könnte.
Sie hatten die Möglichkeit, Digitalisierung mitzugestalten, als diese noch in den Kinderschuhen steckte. Diese Möglichkeit zu experimentieren, scheint in unseren bürokratisierten Strukturen ja leider immer mehr wegzubröseln.
Junginger: Deshalb darf man nicht unterschätzen, welchen Wert Designforschung hat. Einer öffentlichen Verwaltung fehlt schlicht die Zeit, sich auf Experimente einzulassen und auch in Unternehmen ist es bei Weitem nicht so einfach. In der Designforschung haben wir mehr Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren. Unsere Forschungserfahrung können wir dann wiederum zur Verfügung stellen.
Sabine Junginger
Sabine Junginger leitet das Kompetenzzentrum für Design und Management an der Hochschule Luzern - Design & Kunst und ist ausgewiesene Expertin für die Prinzipien, Methoden und Prozesse des Human-Centred Design. Ihre wissenschaftliche Arbeit stützt sich auf ihre beruflichen Erfahrungen im Journalismus, Marketing und der Pressearbeit. Bevor sie Kommunikationsplanung und Informationsdesign an der renommierten School of Design der Carnegie Mellon University studierte, arbeitete sie als Journalistin für Printmedien, bei Designworks/USA, einem BMW-Unternehmen in Newbury Park, Kalifornien, und Siemens Corporate Design in München, sowie beim German American Trade Center in Atlanta.

Citation
This content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license except for third-party materials or where otherwise noted.