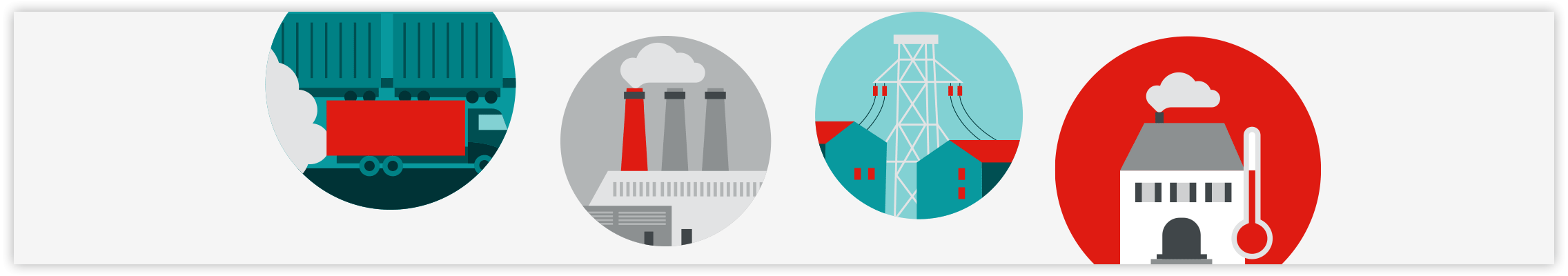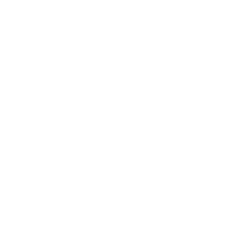magazine_ Article
Ein Brunnen ist nicht die Lösung
Eine Fallstudie aus Angola zeigt, dass Technologie allein bei der Anpassung an den Klimawandel nicht ausreicht, sondern langfristig sogar schaden kann.
Das Bauen von Infrastrukturen wie etwa Brunnen soll in den Ländern südlich der Sahara im Kampf gegen die Dürre helfen. Doch kann dies auch dazu führen, dass die Bevölkerung sesshaft wird und dadurch wertvolles traditionelles Wissen langsam verloren geht, auf das sich die Menschen seit Jahrhunderten bei der Anpassung an extreme Dürreereignisse verlassen haben. Auch wenn das Problem der Trockenheit kurzfristig gemildert wird, könnten die langfristigen Folgen von Brunnen somit eher negativ als positiv sein. Das ist das Ergebnis einer Studie von der Universität Florenz und von Eurac Research.
Millionen von Viehzüchtern sind in Afrika südlich der Sahara von extremen Dürreperioden betroffen, was zu Todesfällen, Hungersnöten und Migration führt. Das Jahr 2022 war nach zehn Jahren anhaltender Hitze und Dürre für die Makroregion eines der trockensten seit Beginn der Aufzeichnungen. Im Süden Angolas beispielsweise wird von der schlimmsten Umweltkrise seit 40 Jahren gesprochen: verschwindende Flüsse, staubige, von der Trockenheit zerrissene Böden, verbrannte Weiden. Eine der Lösungen, die Regierungen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) gewählt haben, um der lokalen Bevölkerung zu helfen, ist der Bau kleiner Wasserinfrastrukturen, die das Wasser zutage bringen, das für die Versorgung der Bevölkerung, des Viehs und der bewirtschafteten Felder benötigt wird. NGOs, Freiwillige und Regierungen arbeiten gemeinsam am Bau von Brunnen, Reservoirs und kleinen Teichen, die für die Landwirtschaft und die Viehzucht notwendig sind. Im Süden Angolas war Luigi Piemontese, Forscher an der Universität Florenz und Experte für Wassermanagement, im Jahr 2021 an einer dieser Brunnenbaukampagnen beteiligt. Ziel des Entwicklungsprojekts war es, während der schweren Dürre das Überleben der lokalen Bevölkerung zu sichern, die hauptsächlich aus nomadischen Viehzüchtern besteht.
Was im Umgang mit der Dürre hilft: traditionelles Wissen oder Technologie?
Brunnen und andere kleine Wasserinfrastrukturen – im Fachjargon SWI oder Small Water Infrastructures genannt – werden oft als Reaktion auf größere Dürreperioden gebaut und haben einen eindeutigen unmittelbaren Nutzen: Sie sichern den Menschen das Überleben, ohne dass sie in andere, weniger trockene Gebiete umziehen müssen. Im Englischen nennt man eine solche Lösung „tech-fix“, also ein technisches Mittel zur Lösung eines Problems. Und das ist auch der Grund, warum Luigi Piemontese sich damit befasst: Seine Aufgabe ist es, die am besten geeigneten Orte für den Bau dieser Infrastruktur zu ermitteln. Der Forscher durchforstet die endlose trockene Landschaft, die den Süden des Landes prägt, in Richtung der Namib-Wüste, die seit über 80 Millionen Jahren trocken ist und als eine der ältesten Wüsten der Welt gilt. Dies ist auch eine Gelegenheit, das traditionelle Wissen der Nomadenvölker kennenzulernen: ein überliefertes Wissen, das aus gesammelten Erfahrungen stammt.
Was passiert, wenn der Brunnen versiegt, um den herum Menschen sesshaft geworden sind?
„Menschen gehen auf unterschiedliche Weise mit extremer Trockenheit und dem Klimawandel um. Eine Strategie, die die Menschen im Süden Angolas bisher genutzt haben, ist das Nomadentum“, erklärt Luigi Piemontese. Die lokale Bevölkerung weiß in der Regel, wohin sie sich bei Dürreperioden begeben muss, um Wasser zu finden. „In dem Gebiet gibt es ein gewisses Trockenheitsgefälle: Es gibt extrem trockene Gebiete, in denen – vor allem bei lang anhaltender Trockenheit – keine Möglichkeit besteht, Land- oder Viehwirtschaft zu betreiben. Es gibt jedoch auch weniger trockene Gebiete, in denen die Bedingungen für den Anbau von Pflanzen und das Weiden von Vieh immer wieder gegeben sind.“ Das Wissen um die besten Plätze und Wege und die Bereitschaft, häufig umzuziehen, haben es den Menschen dort ermöglicht, jahrhundertelang in solchen trockenen Gebieten mit extremen Hitzeperioden zu überleben.
Der Bau von Brunnen ist eine weitere Möglichkeit, sich an die Dürre anzupassen und hat einen größeren unmittelbaren Nutzen als das Nomadentum: Die Menschen müssen nicht umziehen, sondern haben das Wasser zur Hand, das sie für ihre Herden und auch für ihr Selbstversorgung durch die Landwirtschaft benötigen. Bei seinen Besuchen in den Dörfern stellt Luigi Piemontese eine weitere Folge des Brunnenbaus fest: Die Menschen werden rund um den Brunnen sesshafter, was unter anderem auch von der Zentralregierung des Landes sehr geschätzt wird, die so ihre Bevölkerung besser zählen und kontrollieren kann.
Doch was passiert, wenn der gebaute Brunnen – um den sich eine sesshafte Bevölkerung angesiedelt hat – versiegt? Oder wenn ein noch größeres extremes Hitzeereignis eintritt?
Der Forscher konnte dies aufgrund seiner Erfahrungen vor Ort nur vermuten. In der wissenschaftlichen Literatur gab es keine detaillierten Studien über die Folgen des Baus kleiner Wasserinfrastrukturen in Gebieten mit extremer Trockenheit. Daher bat der Forscher der Universität Florenz Stefano Terzi um Hilfe, einen Wasseringenieur von Eurac Research. Gemeinsam erstellten sie ein ganzheitlicheres Modell, mit dem die möglichen langfristigen Folgen analysiert werden können.
„Systemdynamik“ – eine Methode, um die Folgen des Brunnenbaus zu untersuchen
Um ein Modell zu erstellen, greifen die Forscher auf eine Analysemethode zurück, die als „Systemdynamik“ bezeichnet wird. Dieser Ansatz wird verwendet, um das Verhalten eines komplexen Systems im Laufe der Zeit zu verstehen. Ein komplexes System kann eine besonders bizarre Flüssigkeit sein, die Erdatmosphäre, ein Vogelschwarm oder auch die Anpassung einer Bevölkerung an den Klimawandel. „Das sind Muster, die die verschiedenen Teile des komplizierten Puzzles zusammensetzen, das die Realität darstellt. Und sie helfen uns, nach wenig sichtbaren Beziehungen, verborgenen Folgen und Ereignissen zu suchen, die das System aus seinem Gleichgewicht bringen“, erklärt Stefano Terzi. „Die Modelle werden mit Daten gefüttert, und wir haben viele verschiedene verwendet: Satellitenbilder, globale Datensätze und solche, die von lokalen Regierungen zur Verfügung gestellt wurden, sowie Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Literatur. Und wir haben mit den Menschen vor Ort gesprochen und Hirtengemeinschaften befragt.“ Dieser Ansatz brachte mehrere Erkenntnisse zutage. Eines der Ergebnisse ist zum Beispiel der Zusammenhang zwischen dem Bau der Brunnen und der Zunahme der Besiedlung, der auch auf Satellitenbildern zu erkennen ist: Wo Brunnen gebaut wurden, nahmen die Anbauflächen zu und die Weideflächen ab.
"Die Systemdynamik ermöglicht es uns, die verschiedenen Teile des komplizierten Puzzles – die Realität – zusammenzusetzen und dabei auch auf den ersten Blick oft verborgene Zusammenhänge zu erkennen.”
„Die Sesshaftigkeit an und für sich ist natürlich keine schlechte Sache. Aber sie hat Folgen, vor allem, wenn sie sich über einen längeren Zeitraum in einem extrem dürreanfälligen Gebiet wie in einigen Gegenden im Süden Angolas durchsetzt“, erklären Stefano Terzi und Luigi Piemontese. „Sesshafte Menschen verbrauchen mehr Wasser, und wenn diese Brunnen nicht mehr ausreichen – weil sie versiegen oder weil eine weitere, noch stärkere Dürrewelle eintritt – kann es passieren, dass die Bevölkerung, die sich auf diese technische Lösung verlassen hat, in noch größere Schwierigkeiten gerät als zuvor.“ Denn möglicherweise denken die Menschen nicht mehr daran, in Gebiete mit mehr Wasser zu ziehen, auch weil sie in der Zwischenzeit wirtschaftlich investiert haben. Möglicherweise haben sie auch das traditionelle überlieferte Wissen verloren, das sie zum Weiterziehen bewegen würde. Letztlich könnte also der Bau von Brunnen – ohne diese Zusammenhänge zu berücksichtigen – die Situation zwar kurzfristig verbessern, mittel- bis langfristig aber die Lebensbedingungen verschlechtern.
Technologie, Governance und traditionelles Wissen
Studien dieser Art zeigen, dass bei komplexen Themen wie dem Klimawandel auch langfristige und unerwartete Folgen berücksichtigt werden müssen. „Natürlich dürfen wir nicht aufhören, Wasserinfrastrukturen zu bauen“, erklären Luigi Piemontese und Stefano Terzi, „aber wir brauchen auch eine Governance, die diese technologischen Mittel in einen breiteren Kontext stellt. Einen Kontext, der auch soziale Variablen einbezieht – wie das Erhalten von traditionellem Wissen.“ Umsichtige Maßnahmen und eine stärkere Sensibilisierung sowohl der Projektträger als auch der lokalen Bevölkerung sind notwendig, um sicherzustellen, dass die verfügbare Technologie die Lebensweise der nomadischen Hirtenvölker nicht verändert. Langfristig gesehen ist das Nomadentum wahrscheinlich die beste Strategie, um sich an die Dürre in diesem Gebiet anzupassen. Denn es wird sichergestellt, dass die Wasserressourcen nicht in einem Brunnen erschöpft werden und sich der Grundwasserspiegel wieder auffüllen kann. „Ohne Governance läuft man Gefahr, negative Folgen zu verstärken, die langfristig der Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung schaden. Stattdessen sollte die Einführung von Infrastrukturen von einer Reihe von Maßnahmen begleitet werden, die verhindern, dass die Technologie die Lebensweise der Bevölkerung grundlegend verändert“, schlagen die beiden Forscher vor. „Es wäre zum Beispiel hilfreich, die Anzahl und die Dichte der Brunnen zu begrenzen, um zu vermeiden, dass sie die Leute dazu verleiten sesshaft zu werden, oder sie vorausschauend entlang der Routen zu bauen, die bereits von den Viehzüchtern bei ihren Wanderungen genutzt werden“, resümieren sie.
 technical documentation
technical documentationDer wissenschaftliche Artikel in der Fachzeitschrift Nature
Die wissenschaftliche Publikation mit dem Titel „Over-reliance on water infrastructure can hinder climate resilience in pastoral drylands“ wurde in der renommierten Fachzeitschrift Nature Climate Change veröffentlicht. Er kann hier kostenlos eingesehen werden. Autoren sind neben Stefano Terzi von Eurac Research Luigi Piemontese, Giuliano Di Baldassarre, Diego A. Menestrey Schwieger, Giulio Castelli und Elena Bresci.