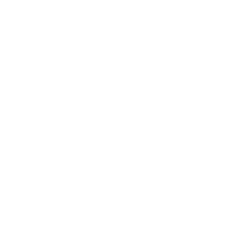magazine_ Interview
Riskante Wissenslücke
Über den Gender Data Gap und warum wir uns damit beschäftigen sollten
Die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen sind in unserer Gesellschaft nach wie vor groß. Sie reichen vom Lohn über die Renten bis hin zur Verteilung der Pflegearbeit, um nur die bekanntesten zu nennen. Sie betreffen außerdem einen Bereich, der besonders tückisch ist: der Mangel an wissenschaftlichen Daten über Frauen in der Medizin – auch Gender Data Gap genannt. Wir sprechen darüber mit Katharina Crepaz, Forscherin am Center for Autonomy Experience von Eurac Research und Expertin für Gender Dynamics, und Giacomo Strapazzon, Arzt und Leiter unseres Instituts für Alpine Notfallmedizin.
Studien zeigen, dass Frauen in der medizinischen Forschung unterrepräsentiert sind. Wie lässt sich dieses Phänomen erklären?
Katharina Crepaz: In der Medizin gibt es den „Normalpatienten“: jung, männlich, weiß, ohne Beeinträchtigung, 1,80 Meter groß und 80 Kilo schwer. Wer von dieser vermeintlichen Norm abweicht, wie Frauen und Minderheiten, ist in den medizinischen Studien unterrepräsentiert. Frauen gelten aus zwei Gründen als „schwierige“ Versuchspersonen: Zum einen aufgrund ihres Zyklus und den Hormonschwankungen, die in Studien als Faktoren berücksichtigt werden müssen, zum anderen aufgrund der potenziellen Möglichkeit einer Schwangerschaft – Medikamententests könnten den Fötus beeinträchtigen.
Giacomo Strapazzon: Tatsächlich ist die Untersuchung von Frauen aufgrund der mit dem Menstruationszyklus verbundenen Hormonschwankungen komplexer. Wenn man die Studie an einer physiologisch homogenen Stichprobe durchführen will, ist es viel einfacher, dies mit männlichen Probanden zu tun. Um den physiologischen Zustand der Teilnehmerinnen zu standardisieren, müsste man den Menstruationszyklus unterdrücken, aber dann würden potenziell interessante Informationen verloren gehen.
In der Medizin gibt es den „Normalpatienten“: jung, männlich, weiß, ohne Beeinträchtigung, 1,80 Meter groß und 80 Kilo schwer. Wer von dieser vermeintlichen Norm abweicht, wie Frauen und Minderheiten, ist in den medizinischen Studien unterrepräsentiert.
Katharina Crepaz
Aber ist die Komplexität der weiblichen Physiologie wirklich ein guter Grund dafür, Frauen nicht in die Forschung einzubeziehen?
Katharina Crepaz: Das ist eine Ausrede, die vor allem ökonomische Gründe hat. Natürlich ist es aufwändiger und kostspieliger, an Frauen Studien durchzuführen, wenn man Faktoren wie Zyklusschwankungen mit einbeziehen muss. Das darf man aber nicht als Rechtfertigung gelten lassen. Die Gesundheitspolitik muss dafür Sorge tragen, dass es eine passende Gesundheitsversorgung für alle Bevölkerungsgruppen gibt, unabhängig von wirtschaftlichen Faktoren. Daher müssen auch für die medizinische Forschung entsprechende Richtlinien umgesetzt werden.
Giacomo Strapazzon: Ich bestätige, dass es notwendig ist, mit den Ressourcen sparsam umzugehen. Allerdings hängt die Einbeziehung eines oder beider Geschlechter auch von der Forschungsfrage ab. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, nur ein Geschlecht zu untersuchen. Wenn man zum Beispiel nicht erwartet, Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern zu finden, kann man sich dafür entscheiden, eine Vorstudie mit den am einfachsten zu untersuchenden Testpersonen, d. h. den Männern, durchzuführen. Wenn man dann interessante Ergebnisse hat, kann man die Forschung vertiefen, indem man sie auf die Frauen ausdehnt. In anderen Fällen ist es jedoch unvermeidlich, weibliche Testpersonen in die Studie einzubeziehen, etwa wenn Therapien für Frauen getestet werden sollen.
Die Einbeziehung eines oder beider Geschlechter hängt auch von der Forschungsfrage ab.
Giacomo Strapazzon
Frau Crepaz, Sie haben sich in ihrer Forschung mit den bestimmenden sozialen Faktoren für die Gesundheit beschäftigt. Die hormonelle Komponente macht die Untersuchung der weiblichen Physiologie komplexer. Aber gibt es noch andere Faktoren, die sich negativ auf die Chancen von Frauen auswirken, in klinische Studien einbezogen zu werden und möglicherweise eine gute Gesundheit zu genießen?
Katharina Crepaz: Zu den biologischen Determinanten der Gesundheit eines Menschen gehören, neben den Hormonen, zum Beispiel auch das Alter und die Erbanlagen. Dann gibt es soziale Faktoren, die eine ebenso wichtige Rolle für den Zugang zu einer angemessenen Versorgung spielen. Damit sind beispielsweise Vorurteile seitens des Gesundheitspersonals gemeint – Studien zeigen, dass die Schmerzen von Frauen als weniger schlimm eingestuft werden als jene von Männern, und dass physische Leiden häufiger als psychische fehldiagnostiziert werden.
Warum ist es wichtig, Frauen in klinischen Studien zu berücksichtigen und deren Ergebnisse nach Geschlecht aufgeschlüsselt zu analysieren? Und welche Risiken bestehen, wenn Frauen nicht in die Gesundheitsforschung einbezogen werden?
Giacomo Strapazzon: Der Ausschluss von weiblichen Testpersonen bedeutet, dass wir von vornherein davon ausgehen müssen, dass die Ergebnisse aus reinen Männerstudien automatisch auch für Frauen gelten. Dies ist jedoch nicht immer der Fall, unter anderem wegen der bereits erwähnten hormonellen Unterschiede. Beispielsweise steigt bei Frauen das kardiovaskuläre Risiko nach der Menopause deutlich an. Um zu wissen, welche Rolle das biologische Geschlecht bei der Entstehung bestimmter Krankheiten spielt, und um Leitlinien zur Prävention und Behandlung zu entwickeln, ist es daher notwendig, Personen beiderlei Geschlechts zu untersuchen. Ganz allgemein kann man sagen, dass die Wirksamkeit einer Behandlung nur dann beurteilt werden kann, wenn sie an der Bevölkerung getestet wurde, für die sie bestimmt ist.
Katharina Crepaz: Ich möchte hinzufügen, dass Frauen die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen. Einen so großen Teil der Bevölkerung von Studien auszuschließen, wäre unverantwortlich und würde bedeuten, keine wissenschaftlich fundierte Grundlage für die Behandlung zu haben. Wir wissen, dass Medikamente bei Frauen oft anders wirken und dass die Dosierung an die unterschiedliche Physiologie der beiden Geschlechter angepasst werden muss. Werden Studien nur am „Normalpatienten“, also dem Mann, durchgeführt, könnte das fatale Folgen für die Gesundheit der Frau haben. Außerdem zeigen Frauen oft andere Symptome als Männer. Etwa beim Herzinfarkt: Dank der Aufklärungskampagnen wissen die meisten Menschen, dass in den Arm ausstrahlende Schmerzen in der linken Brustseite ein Warnzeichen sind. Bei Frauen treten jedoch andere Symptome auf, wie z. B. ein stechender Schmerz zwischen den Schulterblättern. Diese Anzeichen werden häufig nicht mit einem Herzinfarkt in Verbindung gebracht oder zu spät erkannt.
Der Ausschluss von weiblichen Testpersonen bedeutet, dass wir von vornherein davon ausgehen müssen, dass die Ergebnisse aus reinen Männerstudien automatisch auch für Frauen gelten.
Giacomo Strapazzon
In ihrem Buch „Unsichtbare Frauen – Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert“ schreibt Caroline Criado Perez, dass es einigen Wissenschaftlern zufolge schwierig sei, weibliche Studienteilnehmerinnen zu rekrutieren. Was soll man denjenigen entgegnen, die dies behaupten?
Katharina Crepaz: Es gibt verschiedene Bevölkerungsgruppen, die relativ schwer zu erreichen sind: Bei der Teilnahme an Studien sind es Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund, bei Präventionsmaßnahmen sind es Männer. Diese Tatsache sollte jedoch nicht als Rechtfertigung dafür dienen, bestimmte Gruppen von der Forschung und medizinischen Versorgung auszuschließen. Vielmehr sollten für jede dieser Gruppen spezifische Programme geschaffen werden.
Giacomo Strapazzon: Ich würde nicht sagen, dass Frauen in jedem Fall schwieriger zu erreichen sind. Das kann der Fall sein, wenn bestimmte kulturelle Barrieren ins Spiel kommen, wie im Falle von Frauen muslimischen Glaubens. In diesem Fall kann die Durchführung bestimmter Tests kompliziert sein, da sie weit über die Komfortzone der Teilnehmerinnen hinausgehen.
Öffentliche Einrichtungen in verschiedenen Ländern, wie z. B. die National Institutes of Health in den Vereinigten Staaten, schreiben die die Einbeziehung von weiblichen Testpersonen in klinische Studien mittlerweile vor. Ähnliche Bestimmungen finden sich bei Organisationen wie der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie, die Forschende dazu verpflichtet, es zu begründen, wenn sie Probanden nur eines Geschlechts in Studien einbeziehen, die für beide Geschlechter von Interesse sein könnten. Wie ist die Situation in Italien?
Giacomo Strapazzon: Auch Italien geht in die gleiche Richtung wie andere Länder. Die Ethikkommissionen, die Forschungsprojekte genehmigen, fördern die Einbeziehung beider Geschlechter.
Katharina Crepaz: Außerdem hat die Europäische Union im Jahr 2022 neue Regelungen eingeführt, die eine repräsentative Verteilung der Geschlechter und Altersgruppen in klinischen Studien vorschreiben. In Italien hat das ISS (Istituto Superiore di Sanità) im Jahr 2023 Leitlinien für eine geschlechtergerechte medizinische Forschung erlassen, die unterschiedliche Bereiche betreffen und sowohl das biologische als auch das soziale Geschlecht als Faktoren miteinbeziehen. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Die Europäische Union hat im Jahr 2022 neue Regelungen eingeführt, die eine repräsentative Verteilung der Geschlechter und Altersgruppen in klinischen Studien vorschreiben.
Katharina Crepaz
Lassen Sie uns zum Abschluss dieses Interviews noch ein spezielles Thema ansprechen. In einer kürzlich erschienenen wissenschaftlichen Publikation heißt es, dass, obwohl Frauen seit dem Beginn des modernen Alpinismus Berge besteigen, die meisten Studien zur menschlichen Physiologie in großer Höhe an männlichen Probanden durchgeführt wurden. Wie kommt das?
Katharina Crepaz: Ich denke, das hängt wiederum mit der „schwierigeren“ Ausgangslage für Studien durch den weiblichen Zyklus zusammen. Zudem ist das Thema Zyklus und Menstruation gesellschaftlich immer noch stark tabuisiert; wenn Athletinnen darüber sprechen, wie ihre Menstruation ihre Leistungsfähigkeit beeinflusst, was mittlerweile glücklicherweise häufiger passiert, dann ist das selbst 2024 noch eine Schlagzeile wert. In der Sportwissenschaft setzt es sich zunehmend durch, ganz bewusst mit dem Menstruationszyklus zu arbeiten, in Form von zyklusbasiertem Training, das auf die jeweilige Zyklusphase angepasst wird. Ich hoffe, dass solche Ansätze das Tabuthema des weiblichen Zyklus mehr ins gesellschaftliche Rampenlicht holen werden.
Giacomo Strapazzon: Es muss auch gesagt werden, dass das Bergsteigen lange Zeit hauptsächlich von Männern betrieben wurde. In einer von uns durchgeführten Studie, in der Lawinenverschüttungen simuliert wurden, war die Mehrheit der Testpersonen männlich. Das liegt daran, dass wir die Freiwilligen unter Skitourengehern, Bergführern und Mitgliedern der Berg-, und Pistenrettung rekrutiert hatten, alles Tätigkeiten, die immer noch häufiger von Männern als von Frauen ausgeübt werden. Das Situation ändert sich jedoch.
Das Thema Zyklus und Menstruation ist gesellschaftlich immer noch stark tabuisiert; wenn Athletinnen darüber sprechen, wie ihre Menstruation ihre Leistungsfähigkeit beeinflusst, dann ist das selbst 2024 noch eine Schlagzeile wert.
Katharina Crepaz
Das Institut für Alpine Notfallmedizin von Eurac Research hat ein Projekt zur Untersuchung der weiblichen Physiologie in großen Höhen gestartet. Herr Strapazzon, können Sie uns ein wenig darüber erzählen?
Giacomo Strapazzon: Siebzig Jahre nach der Erstbesteigung des K2 hat der italienische Alpenverein CAI (Club Alpino Italiano) eine Initiative ins Leben gerufen, bei der acht Bergsteigerinnen diese Gipfel bestiegen werden. Hier am Institut für Alpine Notfallmedizin werden wir die Physiologie der Alpinistinnen vor und nach der Expedition untersuchen. Im vergangenen März haben die acht Frauen erste Tests im terraXcube, dem Extremklimasimulator von Eurac Research, durchgeführt. Bei diesen Tests wurden die Herz-Kreislauf-, Atem- und Gehirnfunktionen der Teilnehmerinnen bewertet. Im August werden sie die Tests wiederholen, wenn ihr Abenteuer am K2 beendet ist. Ziel ist es, Daten über die physiologischen Prozesse zu sammeln, die der weiblichen Akklimatisierung in extremen Höhenlagen zugrunde liegen.
Welche Auswirkungen könnte diese Studie auf das Leben derjenigen haben, die nicht in großen Höhen leben und keine Berge besteigen?
Giacomo Strapazzon: In großer Höhe nimmt die Sauerstoffmenge ab, die das Körpergewebe erreichen kann. Dieser Zustand wird „Hypoxie“ genannt und kann bei Bergsteigern und Bergsteigerinnen und Menschen mit bestimmten Pathologien auftreten. Die Untersuchung der Reaktion des Körpers auf Sauerstoffmangel kann daher für Patienten und Patientinnen von Nutzen sein, die in der Intensiv- und Subintensivstation behandelt werden.
Katharina Crepaz
Katharina Crepaz ist Senior Researcher am Center for Autonomy Experience von Eurac Research. Sie promovierte an der Universität Innsbruck in Politikwissenschaften und habilitierte sich an der Technischen Universität München für das Fachgebiet Gesundheitswissenschaften.
Giacomo Strapazzon
Giacomo Strapazzon ist Leiter des Instituts für Alpine Notfallmedizin von Eurac Research und Arzt beim italienischen Berg- und Höhlenrettungskorps CNSAS. Er hat an der Universität Padua in Biomedizin promoviert und lehrt in der Facharztausbildung für Notfall- und Sportmedizin.