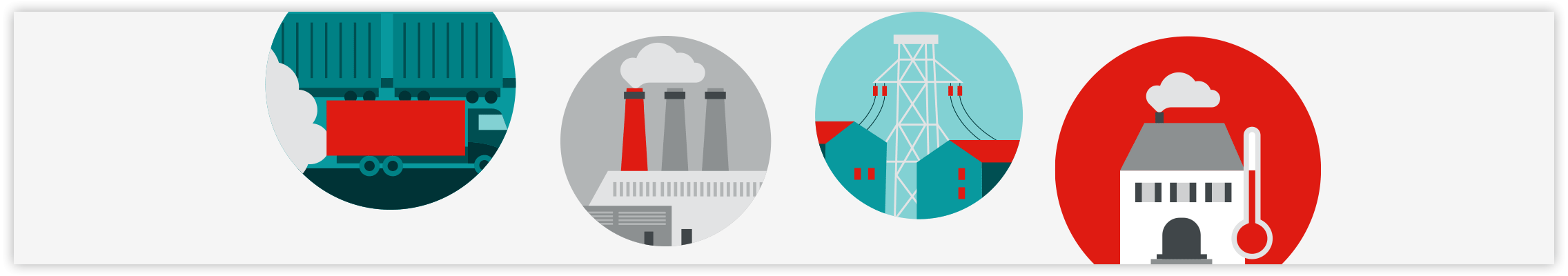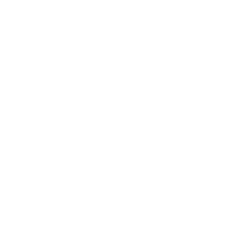magazine_ Interview
„70 Prozent haben vor den negativen Folgen des Klimawandels Angst“
Erstmals wurde das Phänomen Klimaangst in einer Studie für Südtirol thematisiert. Felix Windegger und Christoph Kircher ordnen die Ergebnisse ein
Welche positiven und negativen Emotionen lösen die Auswirkungen der Klimakrise sowie die derzeitigen politischen Bewältigungsstrategien in den Menschen aus? Lässt sich auch in Südtirol so etwas wie Klimaangst feststellen? Und welche Unterschiede gibt es zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen? Das Center for Advanced Studies von Eurac Research und das Landesinstitut für Statistik ASTAT haben Gefühle und Einstellungen in Bezug auf die Klimakrise erhoben. Der Sozioökonom Felix Windegger und der Soziologe Christoph Kircher sind die Autoren der Studie.
Herr Windegger, Herr Kircher, weshalb ist es wichtig, zu erforschen, wie sich die Menschen in Zusammenhang mit der Klimakrise fühlen?
Felix Windegger: Emotionen spielen im Rahmen der Klimakrise eine so große Rolle, weil die Auswirkungen immer stärker spürbar sind. Global und auch in Südtirol. Nicht erst in 10 Jahren, sondern im Hier und Jetzt. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, die Klimaziele zu erreichen. Die Menschen sehen mit eigenen Augen, dass der Klimawandel passiert. Dementsprechend gibt es auch emotionale Reaktionen. Da stellt sich die Frage, was das mit den Menschen macht und wie sie damit umgehen.
Christoph Kircher: Wir haben uns im Vorfeld viel mit bestehenden Umfragen zum Thema Klimawandel auseinandergesetzt und haben festgestellt, dass diese sehr abstrakte und technische Fragestellungen etwa zur CO2-Reduktion oder zu zukünftigen Entwicklungen beinhalten. Dabei ist es so, dass die wenigsten Befragten über vertieftes Wissen zu diesen Themen verfügen und meist lediglich wiedergeben, was sie aus den Medien oder von anderen erfahren haben. In unserer Studie gehen wir davon aus, dass Wissen und Handeln zwei getrennte Ebenen sind. Obwohl viel über die Notwendigkeit, den Klimawandel zu bremsen, gesprochen wird, geschieht in der Praxis zu wenig. Was das Handeln tatsächlich beeinflusst, sind immer auch Emotionen: wie Menschen Dinge emotional wahrnehmen, wie sie die Welt fühlen und wie sie darauf affektiv reagieren. Deshalb haben wir uns entschieden, hierzu eine genauere Studie zu machen.
Nur wenige sind mit den derzeitigen Bemühungen für Klimaschutz zufrieden; das Gefühl der Machtlosigkeit überwiegt
"Es ist notwendig, bei konkreten Maßnahmen von vornherein soziale und ökonomische Abfederungsmechanismen mitzudenken."
Felix Windegger
Wie fühlt sich also die Klimakrise für die Südtirolerinnen und Südtiroler an?
Windegger: Die Ergebnisse zeigen starke emotionale Reaktionen, wobei negative Gefühle deutlich überwiegen. Diese reichen von Besorgnis über die bereits spürbaren direkten Auswirkungen, über Angst vor den zukünftigen Folgen, bis hin zu Frustration und Ohnmacht angesichts der aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Klimakrise. Nur 28 Prozent sind mit den derzeitigen Bemühungen zufrieden. 80 Prozent der Befragten geben an, dass sie mit Sorge auf den Klimawandel und seine Folgen blicken. Es sind vor allem Extremwetterereignisse wie Trockenheit und Wassermangel, aber auch Starkregen und Überschwemmungen, die als besonders besorgniserregend eingestuft wurden. 70 Prozent gaben an, dass ihnen die möglichen Folgen des Klimawandels Angst machen und knapp 40 Prozent der Südtirolerinnen und Südtiroler fühlen sich schuldig, weil sie das Gefühl haben, sie könnten oder sollten mehr für den Klimaschutz tun. Angst und Schuld sind auch im internationalen Kontext vieldiskutierte Emotionen. Diese Gefühle führen wiederum zu erheblichen emotionalen Belastungen, die neben den direkten physischen Auswirkungen des Klimawandels in Zukunft wohl ebenfalls eine Rolle spielen werden. Initiativen wie „Psychologists for Future“ und „Psychotherapists for Future“ beschäftigen sich inzwischen gezielt mit diesen Aspekten.
Vor allem Trockenheit und Wassermangel sowie Starkregen und Überschwemmungen machen den Menschen Sorgen
"In unserer Studie haben wir festgestellt, dass der Klimawandel von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen ganz unterschiedlich wahrgenommen wird."
Christoph Kircher
Negative Gefühle können aber doch auch dazu motivieren, konkrete Maßnahmen schneller voranzubringen, oder?
Windegger: Ja, es gibt tatsächlich Studien zu Emotionen und Klimawandel, die darauf hinweisen. Vor allem negative Emotionen wie Wut oder Ärger können sich durchaus in mehr politischem Engagement oder im privaten Bereich in Verhaltensänderungen niederschlagen. Schwierig wird es bei Gefühlen der Ohnmacht, wenn Menschen resignieren und das Gefühl haben, sie könnten ohnehin nichts mehr verändern.
Kircher: Die Daten zeigen, dass es zwei Arten gibt, mit diesen Gefühlen umzugehen. Einerseits gibt es Menschen, die mit Frustration reagieren. Andererseits gibt es jene, die trotz großer Besorgnis und ernsthafter Auseinandersetzung mit dem Thema optimistisch in die Zukunft blicken und große Hoffnung in technologische Innovationen und Lösungen in der Klimapolitik setzen. In unserer Studie haben wir festgestellt, dass der Klimawandel von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Um ein differenzierteres Bild zu zeichnen und mögliche Spannungen offenzulegen, haben wir die Befragten mit ähnlichen affektiven Haltungen in drei Gruppen unterteilt: die Besorgten, die Misstrauischen und die Gelassenen.
Welche Unterschiede haben Sie zwischen den Gruppen festgestellt?
Kircher: In der Gruppe der Besorgten – 39 Prozent – sind Sorge und Angst besonders stark ausgeprägt. In Bezug auf die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels gaben diese Menschen an, sich besonders wütend, frustriert und machtlos zu fühlen. Die Gelassenen – das sind 36 Prozent – sind zufrieden mit den Bemühungen und haben große Hoffnung, die Klimakrise gut zu meistern. Ihr Vertrauen richtet sich vor allem auf eine technologische Lösung. 25 Prozent der Befragten konnten den Misstrauischen zugeordnet werden. Sie leugnen den Klimawandel zwar nicht, betrachten ihn aber als zweitrangiges Problem. Vorschriften und Appelle für klimabewussteres Handeln werden in dieser Gruppe strikt abgelehnt, Klimaproteste am häufigsten als unangemessen und übertrieben eingestuft. Interessante Unterschiede haben wir nach Geschlecht und Bildungsstatus, aber auch im Hinblick auf wirtschaftspolitische und demokratiepolitische Einstellungen festgestellt. So finden sich unter den Besorgten mehr Frauen. Männer und Menschen mit Mittel- oder Berufsschulabschluss können häufiger der Gruppe der Misstrauischen zugeordnet werden.
Die negativen Folgen des Klimawandels sind ungleich verteilt
Gibt es Ergebnisse, die Sie in der Auswertung besonders überrascht haben?
Windegger: Was wirklich spannend und wohl für Südtirol einmalig ist, sind die Unterschiede in Bezug auf die Sprachgruppen. Personen italienischer Muttersprache sind vermehrt in der Gruppe der Gelassenen, Personen deutscher Muttersprache mehr bei den Misstrauischen und Besorgten zu finden.
Kircher: Wir gehen davon aus, dass das mit der Klimawandeldiskussion im deutschsprachigen Raum zusammenhängt, die dort intensiver geführt wird. Die Muttersprache und die damit verbundene mediale Öffentlichkeit sind unserer Meinung nach die determinierenden Faktoren für die unterschiedlichen emotionalen Reaktionen, nicht etwa der Wohnort oder andere soziodemografische Merkmale.
Windegger: Wir haben auch Unterschiede im Vergleich zu unserer ersten gemeinsam mit ASTAT durchgeführten Studie zum Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel im Jahr 2022 festgestellt. Bei der Frage nach den drei wichtigsten Herausforderungen, steht der Klimawandel noch immer ganz oben in der Rangliste. Einen deutlichen Zuwachs von 12 beziehungsweise 10 Prozentpunkten im Vergleich zu 2022 haben wir aber bei den Themen Zuwanderung und Migration und öffentliche Sicherheit verzeichnen können. Das zeigt, dass 2023 offensichtlich andere gesellschaftliche Probleme im Vordergrund standen, was wohl auch mit den Diskussionen im Vorfeld der Landtagswahlen zusammenhängt.
Was bedeuten diese Erkenntnisse nun ganz konkret für Südtirol?
Windegger: Die Ergebnisse machen deutlich, dass es nicht mehr um die Frage geht, ob es den Klimawandel überhaupt gibt oder ob dieser menschengemacht ist. Es geht darum, wie wir gesellschaftlich und politisch damit umgehen sollen – und an diesem Punkt gehen die Positionen der drei Gruppen oft weit auseinander.
Kircher: Es gibt die Gelassenen und die Besorgten, die bereit sind, ihren Lebensstil anzupassen und auch Aufrufe zu nachhaltigem Handeln positiv aufnehmen. Andererseits gibt es die Misstrauischen, die starkes Ressentiment gegen jene zeigen, die eine Verhaltensänderung oder einen nachhaltigen Lebensstil propagieren. Diese Haltung wird von starken negativen Emotionen begleitet. Manche Menschen kapseln sich ab und sind auch für sachorientierte politische Maßnahmen nicht mehr empfänglich, da sie diese mit einer Agenda in Verbindung bringen, mit der sie nichts zu tun haben möchten. Wer politische Maßnahmen plant, muss mitdenken, dass es hier große Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen gibt.
"Wie wir als Gesellschaft leben wollen, ist eine politische Frage, die gesellschaftlich und nicht wissenschaftlich ausgehandelt werden sollte."
Felix Windegger
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass immerhin 56 Prozent daran zweifeln, dass es eine demokratische Lösung für die Klimakrise geben kann. Wie ist diese Zahl zu interpretieren?
Kircher: Ja, 56 Prozent gaben an, dass sie demokratische Verfahren – zumindest in Ausnahmefällen – vorübergehend aufheben würden, um im Klimaschutz schneller voranzukommen. Nur ein Drittel spricht sich in jedem Fall dagegen aus. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Bevölkerung wenig Vertrauen in die Fähigkeit der Politik hat, den rasanten Veränderungen bewusst und rechtzeitig entgegenzutreten. Die Bevölkerung nimmt sehr wohl wahr, dass die Warnungen zunehmen, bei konkreten Maßnahmen aber wieder und wieder zurückgerudert wird. Wir haben auch festgestellt, dass die Zufriedenheit mit der Klimapolitik eng mit der generellen Zufriedenheit mit der Demokratie zusammenhängt.
Windegger: Eine weitere, auf den ersten Blick paradox erscheinende Erklärung für dieses Ergebnis können fehlende Möglichkeiten zur Partizipation sein. Die Bürgerinnen und Bürger sind kaum in Entscheidungsprozesse involviert. Wenn hinter verschlossenen Türen diskutiert wird, aber keine Taten folgen, kann der Eindruck entstehen, dass das System zu langsam ist, um adäquat zu reagieren. Es gibt Menschen, die die Legitimation der Demokratie in Klimafragen grundsätzlich infrage stellen – aufgrund ihrer Trägheit, aufgrund der Beeinflussung durch Lobbys, aufgrund schleppender Entscheidungsprozesse. Hier muss man aber auch klar festhalten, dass ökoautoritäre Ideen, die von einigen ins Spiel gebracht werden, in vielerlei Hinsicht problematisch sind und keineswegs mehr Klimaschutz garantieren – die empirischen Daten weisen eher auf das Gegenteil hin. Und dann gibt es wieder jene, die sagen, jegliche klimapolitischen Interventionen sind autoritär und deshalb abzulehnen.
Soziale Gerechtigkeit sollte bei Klimawandelfragen stärker berücksichtigt werden
Aber Verbote und Regulierungen gibt es auch sonst. Das beginnt schon bei der Pflicht, sich beim Autofahren anzuschnallen. Warum reagieren Personen gerade bei klimapolitischen Fragen so stark?
Kircher: Es ist tatsächlich ein hochemotionales Thema. Dass Klimapolitik und Fragen der Demokratie so oft gemeinsam diskutiert werden, liegt auch daran, dass der Klimawandel in erster Linie wissenschaftlich definiert wurde. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen ihn durch Szenarien und Modelle sichtbar, aber für viele bleibt er schwer greifbar und nicht persönlich erfahrbar. Obwohl das Bewusstsein für den Klimawandel und seine Auswirkungen mittlerweile in der Gesellschaft angekommen ist, kommen die Lösungsvorschläge weiterhin aus der Wissenschaft. Vereinfacht gesagt, ist die Wahrnehmung oft so: Die Wissenschaft definiert das Problem, bietet Lösungsvorschläge an, während die Politik zu ineffizient scheint, diese umzusetzen. Daher gewinnen Menschen den Eindruck, es sei besser, in wichtigen Fragen direkt den Expertinnen und Experten zu folgen und die Politik auszuklammern. Diese Argumentation folgt aber einer sehr problematischen postpolitischen Logik. Die Wissenschaft kann zwar empfehlen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, aber es ist Aufgabe der Politik, Maßnahmen sozial gerecht zu gestalten und umzusetzen.
Windegger: Wie wir als Gesellschaft leben wollen, ist eine politische Frage, die gesellschaftlich und nicht wissenschaftlich ausgehandelt werden sollte.
Klimaaffekte: drei gesellschaftliche Gruppen
Sie sprechen über soziale Verantwortung. In Ihrer Studie haben Sie auch das Bewusstsein der Südtiroler Bevölkerung im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit in klimapolitischen Fragen erhoben. Wie sensibel sind die Südtirolerinnen und Südtiroler in Bezug auf Fragen der Gerechtigkeit?
Windegger: Wir haben tatsächlich eine hohe Sensibilität für Gerechtigkeitsfragen festgestellt. 60 Prozent nehmen an, dass die Menschen ungleich von den Folgen des Klimawandels betroffen sein werden, wobei Wohnort und sozio-ökonomische Aspekte als häufigste Faktoren genannt wurden. Für 65 Prozent sollte soziale Gerechtigkeit in Klimawandelfragen stärker berücksichtigt werden. Was die Kosten des Klimawandels anbelangt, so gaben 47 Prozent der Befragten an, dass nach dem Verursacherprinzip jene verantwortlich sein sollten, die auch am meisten zur Problematik beitragen. Nur sehr wenige sind der Meinung, dass die am stärksten von den Folgen Betroffenen auch für den Großteil der verursachten Kosten aufkommen sollten. Interessanterweise gaben etwa 20 Prozent an, dass der Klimawandel nichts mit Gerechtigkeit und Ungleichheit zu tun hat.
Kircher: Und damit sind wir wieder bei der soziologischen Betrachtung. Denn diese 20 Prozent empfinden soziale Gerechtigkeit nicht als unwichtig, ganz im Gegenteil. Aber sie haben Angst davor, dass ihre Anliegen von klimapolitischen Überlegungen überlagert und in den Hintergrund gedrängt werden könnten. In Bezug auf demokratische Prozesse zeigen sich besonders die Misstrauischen als am wenigsten zufrieden. Sie geben an, sich kaum politisch selbstwirksam zu fühlen.
"Eine ambitionierte, konsequente und vor allem partizipative Klimapolitik ist notwendig, um die Demokratie neu zu beleben und das Vertrauen in sie zu stärken."
Christoph Kircher
Gesellschaftspolitische Unterschiede zwischen den drei Gruppen: Die Frage der Demokratie
Wie könnte man diesen Ängsten nun entgegenwirken und das Selbstwirksamkeitsgefühl stärken?
Kircher: Eine Maßnahme kann die Einrichtung eines Klimarates sein. Einen solchen gibt es in Südtirol bereits. Erste Ergebnisse sollen demnächst vorgestellt werden. Unsere Studie zeigt, dass man nicht umhinkommt, Klimathemen demokratiepolitisch auszudiskutieren. Eine ambitionierte, konsequente und vor allem partizipative Klimapolitik ist notwendig, um die Demokratie neu zu beleben und das Vertrauen in sie zu stärken. In einem Klimarat geht es darum, Menschen aus der Zivilgesellschaft einzuladen und ein Problem zur Diskussion zu stellen. Expertinnen und Experten werden hinzugezogen, um Wissen zur Problematik zu vermitteln und unterschiedliche Lösungsvorschläge einzubringen. Anschließend diskutiert der Klimarat, in welche Richtung man gehen möchte. Aus der Verbindung von wissenschaftlichem Input und zivilgesellschaftlicher Diskussion können dann Handlungsmaximen an die Politik gerichtet werden.
Windegger: Um alle Gruppen tatsächlich einzubeziehen, wird aber organisatorisches Geschick gefragt sein. Es ist notwendig, aktiv auf die Menschen zuzugehen und bei konkreten Maßnahmen von vornherein soziale und ökonomische Abfederungsmechanismen mitzudenken.
 technical documentation
technical documentationDie Umfrage - Hintergrund und Methodik
Die Bevölkerungsbefragung zum Thema „So denkt Südtirol: Emotionen und Ungleichheiten in der Klimakrise“ ist eine Kooperation von Eurac Research und dem Landesinstitut für Statistik ASTAT. 1.028 Südtirolerinnen und Südtiroler wurden im Sommer 2023 dazu befragt, welche Gefühle und Einstellungen sie mit der Klimakrise und den derzeitigen Bewältigungsstrategien verbinden. Die Umfrage erfolgte auf Basis einer probabilistischen Zufallsstichprobe und lässt daher Rückschlüsse auf die Gesamtbevölkerung zu. Die drei gesellschaftlichen Gruppen wurden mittels Faktor- und Clusteranalysen ausdifferenziert. Es ist bereits die zweite Zusammenarbeit zwischen dem Center for Advanced Studies von Eurac Research und dem Landesinstitut für Statistik ASTAT im Rahmen des ASTAT-Panels „So denkt Südtirol“. Die detaillierten Ergebnisse der Studie stehen zum Download zur Verfügung:
 technical documentation
technical documentationEckdaten der Umfrage
Die Eckdaten der Umfrage sind fester Bestandteil der vollständigen oder teilweisen Veröffentlichung oder Verbreitung der Umfrageergebnisse in den Massenmedien. Die Eckdaten müssen die nachstehenden Angaben umfassen.
Titel der Umfrage: Emotionen und Ungleichheiten in der Klimakrise
1. Subjekt, das die Umfrage durchgeführt hat: ASTAT
2. Name des Auftraggebers und des Käufers: Eurac Research
3. Gebiet, in dem die Umfrage durchgeführt wurde (nur angeben, ob die Untersuchung auf gesamtstaatlicher, regionaler, Provinz- oder Gemeindeebene durchgeführt wurde): Autonome Provinz Bozen - Südtirol (auf Provinzebene)
4. Größe der Stichprobe der Antwortenden, Anzahl oder Prozentsatz der Nichtantwortenden und der durchgeführten Ersetzungen: Stichprobe: 1.028 Antwortende, Nichtantwortende: 119
5. Zeitpunkt oder Zeitraum, zu bzw. in dem die Umfrage durchgeführt wurde: 2023
6. Adresse oder Internetseite, unter der das gesamte nach den in Art. 5 der obengenannten Verordnung vorgesehenen Vorgaben erstellte Umfragedokument eingesehen werden kann: AGCOM-Dokumentation
Gemäß Art. 4 der Verordnung zur Regelung der Veröffentlichung und Verbreitung von Umfragen in den Massenmedien erlassen von der Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen mit Beschluss Nr. 256/10/CSP, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 301 vom 27/12/2010.