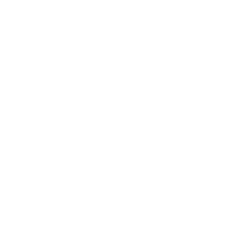magazine_ Interview
Wenn sich die Psyche nach einem Bergunfall verändert
Eine Studie zeigt, dass Menschen zum Teil psychische Belastungsstörungen entwickeln, zum Teil aber auch gestärkt aus dem Unfall hervorgehen können
Ein Unfall am Berg, auch wenn er glimpflich ausgeht, setzt Betroffenen mitunter noch lange schwer zu. 20 Prozent der unfallchirurgisch behandelten Patientinnen und Patienten, die in einer neuen Studie befragt wurden, litten sechs Monate nach einem Bergunfall unter Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Für den Notfallmediziner Hermann Brugger, der schon in früheren Studien posttraumatische Störungen von Lawinenopfern untersucht hat, ist es eine besonders spannende Erkenntnis, dass ein Drittel der Befragten gestärkt aus einer solchen negativen Erfahrung hervorgegangen ist.
Was versteht man genau unter einer posttraumatischen Belastungsstörung?
Hermann Brugger: Die Hauptsymptome sind Zwangserinnerungen; Betroffene müssen sich bei jeder Gelegenheit, die mit einem erlittenen Unfall in Verbindung gebracht wird, daran erinnern. Und nicht nur das, die Erinnerung ist negativ besetzt. Das sind sogenannte Flashbacks. Sie können akustisch oder auch optisch sein. Beispielsweise kommt es bei Lawinenopfern häufig vor, dass sie, wenn sie nur ein Rauschen vernehmen, sofort eine drohende Lawine hören. Solche Zwangserinnerungen sind nicht unbedingt lebensgefährlich, aber sie sind extrem lästig und beeinträchtigen die Lebensqualität sehr. Auch Träume sind häufig – und Vermeidungshandlungen: Handlungen oder Tätigkeiten, die zu Flashbacks bringen können, werden vermieden; es gibt zum Beispiel Menschen, die nach erlebten oder miterlebten Verkehrsunfällen nicht mehr selbst mit dem Auto fahren, weil sie Erinnerungen vermeiden wollen.
Wie überraschend war es dann, dass der Großteil der Befragten nach einem Bergunfall sich wieder in dieselben Situationen wie vorher auf den Berg begibt und zum Teil sogar gestärkt aus dem Unfall hervorgeht?
Brugger: Das Neue und Überraschende für mich ist, dass die Gruppe derer, die nach einem Unfall psychisch gesehen sogar noch resilienter sind als vorher, gleich groß ist wie die Gruppe derer, die eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) entwickelt haben. Ich skizziere kurz die Studie, die unter der Leitung von Katharina Hüfner von der Medizinischen Universität Innsbruck durchgeführt wurde: Befragt wurden 307 Menschen, die nach einem Bergunfall ins Krankenhaus gekommen sind. Es waren vor allem Ski- und Radunfälle. Die Befragung wurde online abgewickelt mit verschiedenen psychologischen Tests, die spezifisch auf PTBS eingehen, aber auch auf die Resilienz, die Lebensqualität, auf Angstsymptomatiken und Depression. Es waren also verschiedene so genannte „Testbatterien“, die durchgespielt wurden. So detailliert ist dem bislang noch nie nachgegangen worden. Aus den Daten haben wir dann über eine Clustersuche drei verschiedene Gruppen identifiziert: die Gruppe derer, die Symptome von PTSD entwickelt haben; die Gruppe der Neutralen, für die sich nach dem Unfall nichts verändert hat; und die Gruppe mit „Posttraumatic Growth“, also jener, die aus dem schlimmen Erlebnis eine positive Kraft für sich gewinnen konnten und psychisch gestärkt daraus hervorgehen. Und alle drei Gruppen waren in unserer Stichprobe ungefähr gleich verteilt. Auch wenn sie nicht repräsentativ ist, ist diese Verteilung schon sehr interessant. Man sagt ja so landläufig ‚was einen nicht umbringt, macht einen stärker‘. Dieses Zitat von Friedrich Nietzsche stimmt in diesem Fall.
Nichtsdestotrotz hat immerhin ein Drittel der Befragten nach einem Bergunfall Symptome einer psychische Belastungsstörung entwickelt.
Brugger: Ja, die Studie eröffnet einen neuen Aspekt der Posttrauma-Forschung. Aber sie zeigt auch auf, wie wichtig die frühzeitige Erkennung von PTBS -Symptomen und die Betreuung der Betroffenen ist. In diesem Zusammenhang haben wir bei der Befragung gesehen, dass ungefähr zehn Prozent der PTBS-Betroffenen in psychologischer Betreuung waren. Zusätzliche sieben Prozent hätten das für notwendig erachtet, haben aber keine Hilfe bekommen. Das heißt, es gibt hier noch einiges zu tun. Die Prävention ist hier wichtig, um Belastungsstörungen zu vermeiden oder die Folgeerscheinungen zu verringern. Denn man darf nicht vergessen, dass das Bergsteigen einen wichtigen gesundheitsfördernden Effekt hat –Bergsteigen macht gesund. Die Südtiroler Bevölkerung liegt europaweit im Spitzenfeld, was die Lebenserwartung betrifft, und das ist durchaus auf die körperliche Betätigung zurückzuführen. Es wird regelmäßig auf den Berg gegangen, Rad gefahren, und so weiter. Das wirkt sich zusammen mit der medizinischen Versorgung auf die Gesundheit aus. Was wir auch wissen, ist, dass Menschen, die regelmäßig Bergsport betreiben, eine höhere Resilienz haben, also besser mit negativen Erlebnissen umgehen können. Daher sind sie von sich aus schon besser geschützt vor PTBS-Symptomen. Dass das Radfahren auf dem Berg, das Skifahren oder das Bergsteigen mit einem gewissen Unfallrisiko verbunden sind, ist klar. Aber wir wissen eben auch, dass sich das Bergsteigen und die Höhe sehr positiv auch auf die psychische Gesundheit des Menschen auswirkt. Deshalb muss man immer den ganzen Zusammenhang sehen.
Die Studie „Three distinct patterns of mental health response following accidents in mountain sports: a follow‑up study of individuals treated at a tertiary trauma center”
Das Forschungsteam lud erwachsene, deutschsprachige Patientinnen und Patienten, einige Monate nachdem sie aufgrund eines Alpinunfalls an der Univ.-Klinik für Orthopädie und Traumatologie Innsbruck behandelt worden waren, zur Teilnahme an einer Online-Befragung ein. Die insgesamt 307 Teilnehmenden hatten leichte (37 Prozent), moderate (35 Prozent) und schwere (28 Prozent) Verletzungen erlitten. Die meisten dieser Unfälle waren beim Skifahren oder Snowboarden auf gesicherten Pisten (knapp 60 Prozent), gefolgt von Fahrradfahren und Wandern passiert. Ziel der Befragung war es, herauszufinden, wie die Verunfallten das Ereignis psychisch verarbeitet haben.
Das Ergebnis: Die Befragten konnten drei Gruppen von psychischen Reaktionsmustern zugeordnet werden. Ein Drittel zeigte keinerlei Symptome einer PTBS und war auch sonst psychisch gesund. Ein weiteres Drittel, das im Schnitt jünger war als die restlichen Teilnehmenden, zeigte Symptome, die auf eine PTBS hindeuten können und gleichzeitig Symptome von Depression, Panik und Angst. Das charakteristische Merkmal der dritten Gruppe war das so genannte posttraumatische Wachstum, also eine verstärkte Resilienz, durch die die Personen gestärkt aus dem Unfall hervorgingen.
Link zur publizierten Studie im European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience: https://doi.org/10.1007/s00406-024-01807-x
Hermann Brugger
Der Notfallmediziner Hermann Brugger hat das Institut für Alpine Notfallmedizin von Eurac Research aufgebaut und leitete es von 2009 bis 2022. Brugger hat bereits vor einigen Jahren das Auftreten von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTSD) bei Lawinenopfern untersucht und die Innsbrucker Forschungsgruppe rund um Katharina Hüfner bei der Konzeption der Fragebogenstudie unterstützt.