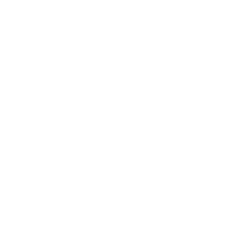Krisenmanagement: eine Frage der Demut

Jakob Rhyner ist Professor für Globalen Wandel und Systemische Risiken an der Universität Bonn. Er war Vizedirektor der Universität der Vereinten Nationen (UNU) in Europa, Direktor des dortigen Instituts für Umwelt und menschliche Sicherheit und hat sich zuvor vor allem im Risikomanagement im Bereich der Schnee- und Lawinenforschung einen Namen gemacht. Eurac Research hat mit ihm über nachhaltiges Krisenmanagement und Parallelen zur aktuellen Covid-19-Pandemie gesprochen.
Herr Rhyner, Sie beschäftigen sich in vielfältiger Weise mit Umweltrisiken, seien es natürliche als auch vom Menschen gemachte. Welche Parallelen lassen sich zu unserer heutigen Situation ziehen, wo wir mitten in einer Pandemie stecken und kaum auf Erfahrungswerte zurückgreifen können?
Jakob Rhyner: Nun, es gibt einen ganz fundamentalen Unterschied zwischen Naturgefahren und der Covid-19-Pandemie. Jede Naturgefahr, sogar eine Dürreperiode, ist letzten Endes zeitlich beschränkt. Es sind mir wenige Naturgefahren bekannt, bei der wir nicht ungefähr sagen könnten, wann und wie sie gebannt oder damit umgegangen werden kann. Corona hingegen wird uns wohl auf unbestimmte Zeit begleiten. Deshalb ist es bei Naturgefahren einfacher, Maßnahmen zu ergreifen. Bei einer Dürre kann es einen ganzen Sommer dauern, bei Lawinengefahr eine Woche, bei Hochwasser kann es beliebig schlimm werden, aber auch dort kann man sich relativ schnell wieder ans Aufräumen machen. Eines der größten Probleme der Covid-19-Pandemie ist, dass man Learning by Doing betreiben muss. Ich habe das Gefühl, die verantwortlichen Politiker sind in der ständigen Position sich entschuldigen zu müssen. Was nicht notwendig wäre, denn auch sie können wenig anderes tun, als gemeinsam mit der Wissenschaft und der Bevölkerung zu lernen. Manche Maßnahmen sind gut, manche nicht, manches muss man ändern.
Was ist bei Naturgefahren einfacher?
Rhyner: Bei Naturgefahren haben wir meist gute Erfahrungswerte und hatten bereits die Gelegenheit zu üben. Da man im Normalfall auch mehr Erfolgs-als Misserfolgserlebnisse hat, vergrößert das das Vertrauen der Bevölkerung. Wenn aufgrund von Lawinengefahr eine Straße gesperrt ist, kann einen das zwar ärgern, aber da weiß man, so falsch wird diese Maßnahme nicht sein. Dann gibt es andere Gefahren wie großflächige Rutschungen, wo unter Umständen ganze Dörfer in Bewegung sein können. Dort hat man es in gewissem Sinn mit einem ähnlichen Phänomen wie bei Covid-19 zu tun, denn auch dort weiß man nicht, ob und wann eine Rutschung zu einem Stillstand kommt und es ist für die Verantwortlichen sehr schwierig und sehr aufreibend eine Entscheidung zu treffen, etwa zu evakuieren, oder nicht. Eine weitere interessante Parallele zur Covid-Situation: Es ist bei Naturgefahren relativ einfach, Maßnahmen zu ergreifen, doch schwieriger, Restriktionen wieder zu lockern. So hat sich etwa die Bevölkerung im Sommer einen schnelleren Rückbau der Corona-Maßnahmen erwartet als die Politik verantworten konnte. Das beobachten wir bei Lawinen auch. Straßen werden geschlossen, wenn es stark schneit. Da ist es für jeden offensichtlich, dass eine Gefahr besteht. Ist das Wetter wieder schön, die Lawinengefahr aber noch immer hoch, ist es schon schwieriger zu erklären, warum eine Straße nicht freigegeben werden kann. Hier gibt es durchaus auch Konflikte zwischen Sicherheits- und wirtschaftlichen Interessen im Krisenmanagement.
Welche Schlüsse ziehen Sie für die Risiko- und Vulnerabilitätsforschung und wie könnten Modelle für ein zukünftiges Krisenmanagement aussehen?
Rhyner: Bei den Naturgefahren wurden die großen Fortschritte durch Analysen der Schadensereignisse gemacht. Daraus wurden Lehren gezogen und schließlich umgesetzt. Dabei ist eine gute Fehlerkultur nötig: Es geht bei diesen Analysen nicht darum, wer oder welche einzelne Organisation Fehler gemacht hat, sondern was alle zusammen besser machen können. Bei Naturgefahrenereignissen werden solche Analysen mit zeitlichem Abstand gemacht. Dies ist vermutlich bei Corona schwieriger, da das Ende nicht absehbar ist. Ein großer „Vorteil“ vom Standpunkt der Analyse her ist aber, dass die Pandemie flächendeckend ist, sodass sehr viele unterschiedliche Vorgehensweisen erprobt werden und man voneinander lernen kann.
Sind wir vielleicht auch zu verwöhnt? Sind wir es gewöhnt, dass Risiken von uns ferngehalten werden? Inwieweit müssen wir denn lernen, mit Risken zu leben?
Rhyner: Ich konnte zum größten Teil immer mit Sicherheitsverantwortlichen zusammenarbeiten, die sehr demütig waren. Demut bedeutet, sich bewusst zu sein, dass man eine Gefahrensituation nie zur Gänze im Griff haben kann. Im Sicherheits- und Krisenmanagement ist das nicht nur eine moralische oder ethische Frage, sondern eine Frage der Sicherheit. Sicherheitsverantwortliche, welche sich zu sicher fühlen, neigen dazu, gefährlich zu agieren, und vergrößern Risiken eher, anstatt sie zu reduzieren. Demut führt letztlich auch dazu, dass man nicht jede Fehlentscheidung als Schuld anlastet und damit Lernprozesse ermöglicht. Und ja, wenn man in die Berge geht und meint, man komme da immer ohne Probleme durch, dann ist man verwöhnt und auch im Umgang mit der Covid-19-Pandemie täte ein gewisses Maß an Demut gut.
Im Falle der aktuellen Pandemie kam immer wieder ein globales oder zumindest europäisches Krisenmanagement zur Sprache. Welches wären die Rahmenbedingungen, um ein solches zu ermöglichen oder sprechen wir hier von einer reinen Utopie?
Rhyner: Mit dem Emergency Response Coordination Centre (ERCC) besteht auf EU-Ebene ein Zusammenarbeitsmechanismus, das sich bei Umweltereignissen schon bewährt hat. Dem gingen aber lange intensive Beratungen voraus. Covid-19 war offensichtlich Neuland für die europäische Zusammenarbeit und die Anfangsphase war teilweise gar von Abschottung geprägt. Zwar wurden inzwischen Fortschritte gemacht; es wird aber aus dieser Krise viel zu lernen und zu verbessern sein. Es bleibt zu hoffen, dass die Weisheit, dass Krisen Chancen sind, sich auch in diesem Fall bewahrheitet. Dasselbe gilt auf globalem Niveau, auch wenn ich finde, dass die WHO besser agiert als ihr oft nachgesagt wird. Man darf bei aller internationalen Koordination nicht vergessen, dass sie zwar die Rahmenbedingungen liefert, dass das eigentliche Krisenmanagement aber auf der unterst möglichen Ebene funktionieren muss. Man nennt das oft das Subsidiaritätsprinzip. Ein guter Grund für dieses Prinzip ist nicht nur, dass Maßnahmen zielgerichtet und angepasst eingesetzt werden können, sondern dass auch das lokale politische Commitment da ist. Wichtig ist die regionale Zusammenarbeit in Grenznähe. Im Dreiländereck Basel gibt es beispielsweise ein Rettungssystem, wo Rettungshubschrauber aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz in Notlagen in alle Richtungen fliegen.
Was ist für Sie Nachhaltigkeit? Was muss ein nachhaltiges Risikomanagement beinhalten?
Rhyner: Ich würde vom englischen Begriff Sustainability ausgehen und ihn neu zusammensetzen. Ich würde von der „ability to sustain“ sprechen, von der „Fähigkeit zu erhalten“ also. Nachhaltigkeit ist für mich kein Zustand, sondern eine Fähigkeit, systemwichtige Funktionen aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. Wenn wir von nachhaltigem Risikomanagement sprechen, müssen wir zunächst verstehen, dass die heute systemrelevanten Funktionen andere sind als noch vor 300 Jahren. Wenn es früher die Sorge gab, überhaupt am Leben zu bleiben, so wollen wir heute nicht nur überleben oder gesund bleiben, wir wollen es auch schön haben. Doch auch, was schön ist, hat sich verändert. Aktuell sind die verschneiten Berge und die Gletscher ein Element der Schönheit. Sind diese mit den Klimawandel einmal nicht mehr da, wird man andere Narrative finden.
Im Umgang mit Naturgefahren liegt ein schmaler Grat zwischen den Interessen des Menschen und jenen der Natur selbst. Wie können wir Risk-Management betreiben, ohne unverhältnismäßig in die Natur und ihre Prozesse einzugreifen?
Rhyner: Ich war immer dagegen, Mensch und Natur gegenüberzustellen. Wenn der Mensch in den letzten tausend oder hundert Jahren überhaupt nicht in die Natur eingegriffen, ursprüngliche Landschaften zu Kulturlandschaften verändert hätte, wären die Alpen kaum bewohnbar. Fakt ist: wir haben die Alpen nur durch größte Eingriffe zu dem schönen Zuhause gemacht, das sie heute sind. Und es würden sich wohl nur wenige Menschen finden, die die Kulturlandschaft der Dolomiten nicht erhaltenswert finden würden. Um das zu leisten, braucht es aber Menschen. Und diese Menschen hatten vor 100 Jahren andere Ansprüche als heute. Man hatte andere Ansprüche, was die Erreichbarkeit einer Alm anbelangt. Man war bereit, alles hochzutragen. Heute muss man die Erschließung durch Wege zulassen, um eine Almwirtschaft am Leben zu erhalten. Um aber zu beantworten, inwiefern das nachhaltig ist, muss man klären, was man nachhalten oder erhalten will und diese Frage hat man in Frankreich, im Aostatal und in Südtirol auch ganz unterschiedlich beantwortet.
Nachhaltigkeit ist also weder ein allgemeingültiges noch langfristiges Konzept?
Rhyner: Ich würde zwar nicht von Kurzfristigkeit sprechen, aber man sollte auch nicht auf 200 Jahre vorausplanen. Da brauchen wir nur um dieselbe Anzahl an Jahren zurückschauen und sehen, wie viele Änderungen es gegeben hat, die damals niemand vorhergesehen hat. Planen sollte man in einem Rahmen von 30 Jahren und möglichst so, dass man nachbessern kann.
Jakob Rhyner
Jakob Rhyner ist Professor für Globalen Wandel und Systemische Risiken an der Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Bonn. Zwischen 2010 und 2018 war er Vizerektor der Universität der Vereinten Nationen in Europa und Direktor des Instituts für Umwelt und menschliche Sicherheit (UNU), wo er sich mit anwendungsorientierter Forschung zu Umweltrisiken, einschließlich umweltbedingter Migration, Klimarisiko-Versicherung, sowie Ausbildung beschäftigte. Zuvor war er Leiter des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos Schweiz. Sein Verantwortungsbereich umfasste Frühwarnsysteme für Lawinen und alpine hydrologische Gefahren, Mess- und Beobachtungnetze, Risikomanagement, sowie die Ausbildung von Sicherheitsverantwortlichen. Er war einer der Speaker beim ersten Global Mountain Sustainability Forum 2020, das aufgrund der Corona-Pandemie als reine Online-Veranstaltung organisiert wurde.

Citation
This content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license except for third-party materials or where otherwise noted.