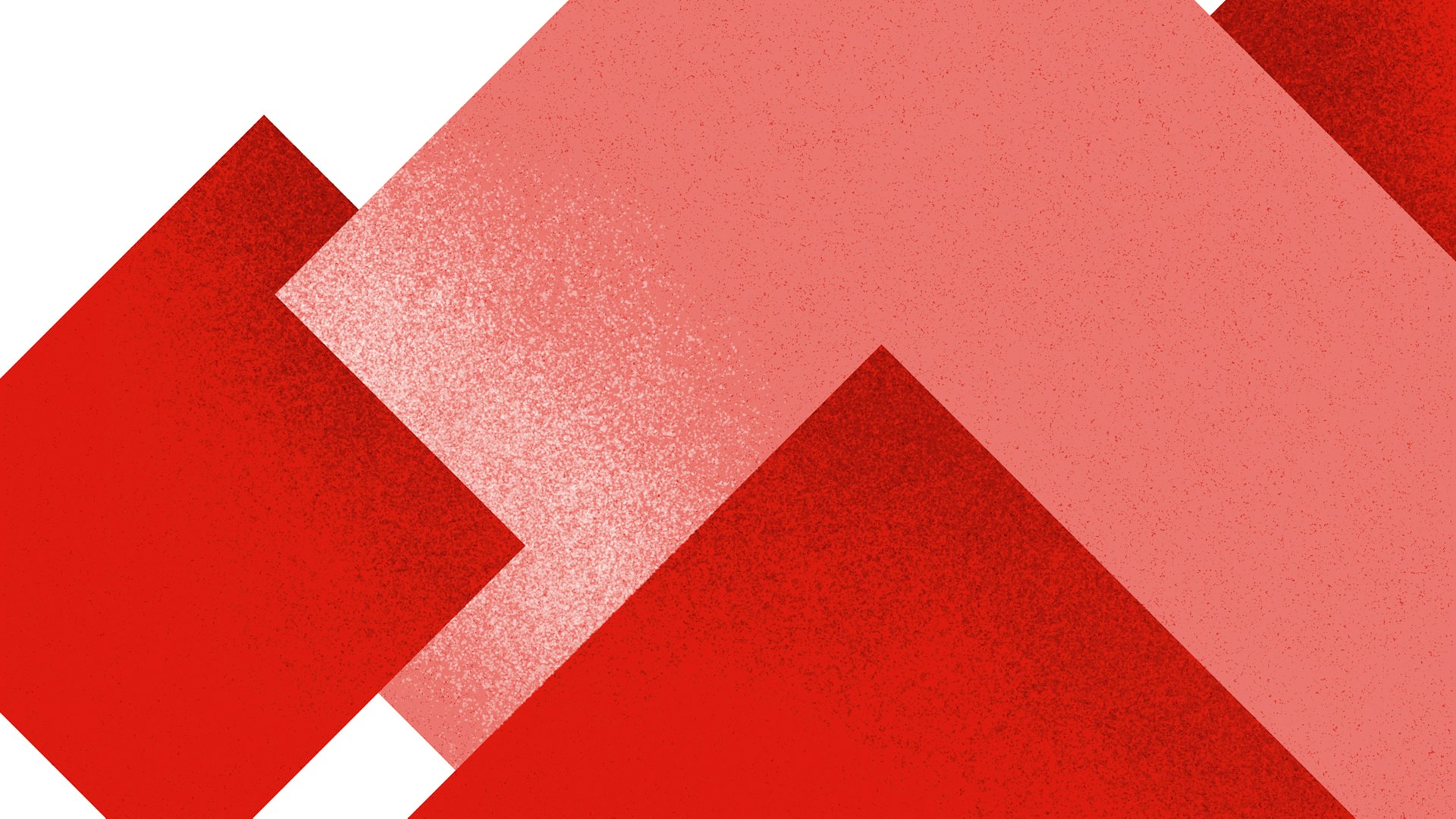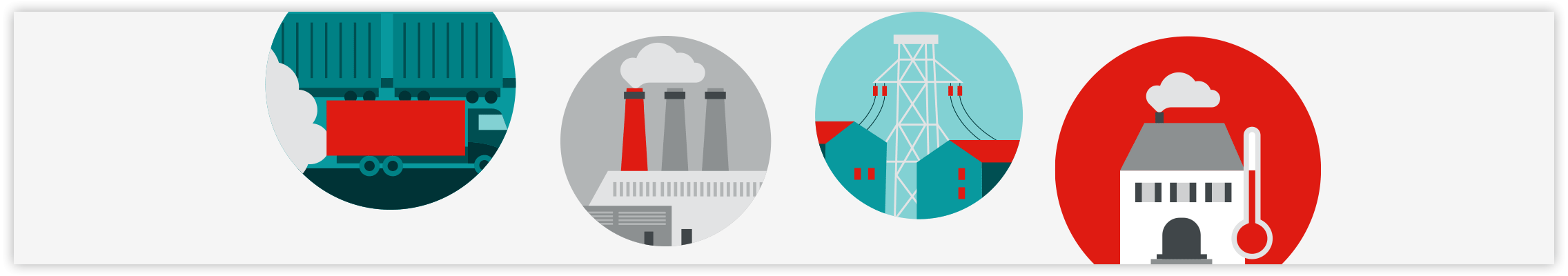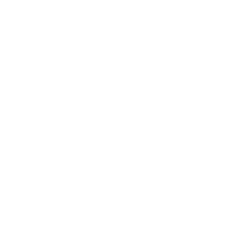magazine_ Interview
„Die Direttissima ist selten machbar“
Gespräche zwischen Disziplinen: Die Ökologin Ulrike Tappeiner und der Notfallmediziner Hermann Brugger im Interview.
Das Thema Berg eint sie: Die Ökologin Ulrike Tappeiner untersucht seit vier Jahrzehnten alpine Ökosysteme und führt Buch über Klimawandel und Biodiversität. Der Notfallmediziner Hermann Brugger erforscht die Auswirkungen der Höhe auf den menschlichen Körper. Beide arbeiten mit riesigen Datensätzen, denen sie in monate-, oft jahrelanger Arbeit Antworten auf wissenschaftliche Fragestellungen entlocken. Das ist aufwändig, aber der einzige Weg, um unsere komplexe Welt schrittweise besser zu verstehen.
Was machen Menschen mit Bergen?
Ulrike Tappeiner: Wenn ich es erdgeschichtlich betrachte, also über einen sehr langen Zeitraum, dann machte der Mensch wenig mit den Bergen. Allerdings besiedelte er zum Beispiel schon in der Bronzezeit die Alpen, wobei bevorzugt die Gebiete über und um die Waldgrenze für die Weidewirtschaft genutzt wurden. Wenn ich mir die letzten Jahrzehnte anschaue, dann führt uns der Klimawandel klar vor Augen, wie der Mensch nicht nur die Berge, sondern den ganzen Planeten beeinflusst. Wobei zu bemerken ist, dass ein Fünftel der Landoberfläche Gebirge ist, und sich der Klimawandel im Gebirge besonders stark auswirkt.
Klimawandel ist ja nun ein indirekter Einfluss des Menschen auf die Berge. Wie steht es um den direkten Einfluss?
Tappeiner: Natürlich nutzt der Mensch den Berg auch intensiv. Denken wir nur an die touristische Nutzung in den Alpen, oder auch den Waldrückgang und die Walddegradierung in vielen Gebirgen der Erde, wie etwa im Kaukasus oder im Karakorum. Aber global gesehen, von den Anden bis hin zum Hindukusch, fällt dieser direkte Einfluss nur in manchen Teilen der Gebirge ins Gewicht, der indirekte Einfluss über den Klimawandel wirkt sich dagegen bis in den letzten Gebirgswinkel aus. Ein klassisches Beispiel ist das Verschwinden der Gletscher und die damit einhergehenden Veränderungen im Wasserhaushalt. Mehr als die Hälfte der Menschheit hängt vom Wasser aus den Gebirgen ab. Berge können aufgrund der Erderwärmung auch Rückzugsgebiete für Pflanzen, Tiere und zunehmend auch für Menschen sein. Wenn die Temperatur steigt, wird es trockener, es kommt zu Ernteausfällen und die Häufigkeit von krankheitsübertragenden Insekten nimmt in Tallagen zu. Auch dies kann Menschen dazu veranlassen, sich ins Gebirge zurückzuziehen.
Haben Sie persönlich im Lauf Ihrer Forschungskarriere Veränderungen aufgrund des Klimawandels wahrgenommen, die Sie in der Schnelligkeit, mit der sie eingetreten sind, überrascht haben?
Tappeiner: Ja, natürlich. Am eindrücklichsten ist der Gletscherschwund. Seit meiner Jugend mache ich fast jährlich Urlaub im Laaser Tal. Und ich erinnere mich noch genau an den fantastischen Hängegletscher und wie das blaue Eis durchgeschimmert hat. Heute gibt es ihn nicht mehr. Vor 40 Jahren war es niemandem bewusst, dass der Rückgang des Gletschers ein erstes Anzeichen des Klimawandels war.
Herr Brugger, als Notfallarzt und höhenmedizinischer Forscher beschäftigen Sie sich mit Menschen, die sich weit über die Baumgrenze hinaus vorwagen. Was macht der Berg mit dem Menschen?
Hermann Brugger: Die Beziehung zwischen Mensch und Berg hat viele Facetten und wandelt sich ständig. Bis vor etwa 200 Jahren wurde das Gebirge als etwas Bedrohliches angesehen. Von ihm gingen Bergrutsche, Lawinen, Überschwemmungen aus. Es rankten sich aber auch viele Mythen um den Berg, auch unsere Dolomiten sind von Sagen umwoben. Zum alpinistischen Ziel ist der Berg erst im neunzehnten Jahrhundert geworden, als allen voran britische Bergsteiger die Alpengipfel erklommen. Der Erste Weltkrieg wurde in den Alpen als erbitterter Kampf um strategisch wichtige Gipfel ausgefochten, und das hat seine Spuren in unserer Sprache hinterlassen. Heute noch werden Berge erobert und Gipfel gestürmt. Seit den 1970er Jahren ist der Berg offen für den Massensport. Der Berg hat sich nicht verändert. Verändert hat sich der Mensch. Der Berg ist nach wie vor bedrohlich, der Mensch ist heute nur besser gerüstet. Er hat sich dem Berg angepasst.
Aber auf unseren Organismus hat die Höhe doch bestimmte Auswirkungen? Wie kamen sie als junger Mediziner zum Entschluss, diese zu erforschen?
Brugger: Ich war schon immer in den Bergen unterwegs, und da war es nur logisch, dass ich mich nach meiner Ausbildung zum Notarzt auch früh als Bergrettungsarzt betätigt habe. Schnell habe ich bemerkt, dass es kaum evidenzbasierte Daten für die alpine Notfallmedizin gibt. Sie lebte damals von Überlieferungen und Anekdoten. Also habe ich angefangen, systematisch Daten zu sammeln und zu analysieren. In Südtirol gab es keine, und so habe ich bei den Schweizer Kollegen angeklopft.
Sie haben uns einmal sogar von einem Selbstversuch erzählt, bei dem Sie sich im Schnee vergraben ließen, um zu sehen, was passiert, wenn man nur eine winzige Atemhöhle hat.
Brugger: Das war am Stubaier Gletscher, mit meinem Kollegen Günther Sumann. Damals war die gängige Meinung unter Anästhesisten, dass ein Verschütteter nach spätestens fünf Minuten erstickt, wenn sein Gehirn nicht mit Sauerstoff versorgt wird. Daten und Berichte der Schweizer Bergrettung deuteten aber auf eine längere Überlebensphase hin – bis zu unglaublichen 18 Minuten. Ich vermutete, dass die Witterungsbedingungen, die Temperatur und der Schnee hier eine entscheidende Rolle spielten. Mir fehlte aber die Beweisgrundlage, also habe ich mich vergraben lassen. Zurückblickend sehe ich, wie verrückt das war. Und mir ging es auch richtig elend.
Frau Tappeiner, wie sind Sie zu Ihren Forschungsfragen gekommen?
Tappeiner: Nicht durch so brutale Selbstversuche (lacht). Aber auch ich habe mich in meiner frühen Forscherzeit mit dem Thema Schnee befasst, genauer genommen mit der Skipistenökologie. Es ging damals, in meiner Dissertation, um die Frage, wie sich planierte Skipisten in ihren ökologischen Auswirkungen von unberührten Almweiden unterscheiden. Das war in einem Skigebiet im Gasteinertal. Wir haben dort festgestellt, dass die CO2-Konzentration bei präparierten Pisten am Boden höher ist, weil ja die Luft beim Präparieren des Schnees herausgepresst wird. Der damalige Chef der Arlberger Seilbahnen meinte ironisch: Das wüssten sie schon lägst, weil die Schneemäuse immer mit Gasmasken herumlaufen. So etwas kann man schon mal zu hören bekommen, wenn man von den Höhen der Grundlagenforschung in die angewandte Wissenschaft hinabsteigt, aber genau dies fasziniert mich auch an meiner Arbeit.
Wie haben Sie damals Daten erhoben? Die Ökologie war im Unterschied zur alpinen Notfallmedizin ja schon eine etablierte Disziplin.
Tappeiner: Daten gab es, aber das Erheben und mehr noch das Speichern war mühsam. Zu Beginn der 1980er Jahre gab es keine Datenlogger, man musste sich alles selbst bauen. Ich habe selbst meine Datenlogger gelötet. Mein akademischer Lehrer war Experimentalphysiker und hat kleine Rechner verwendet zum Datenspeichern. Ähnlich einer Registrierkasse haben sie die Daten auf einer Kassenrolle ausgedruckt. Ich habe dann in wochenlanger Arbeit die Daten eines gesamten Sommers zum Mikroklima – Temperatur, Strahlungsverhältnisse, Luftfeuchtigkeit usw. – und die selbst programmierten Auswertungen dazu auf Lochkarten übertragen und diese den Operatoren unserer Großrechenanlage an der Uni Innsbruck übergeben; das waren damals unsere Götter in Weiß, die Wächter über unsere Daten. Einige Tage darauf konnte ich die Auswertung abholen – vorausgesetzt, ich hatte keinen Programmierfehler gemacht.
Haben Sie diese alten Datenbänder noch?
Tappeiner: Ja, in meinem Büroschrank. Manches davon ist nicht mehr lesbar, anderes schon. Ich habe mir vorgenommen, mich nach meiner Pensionierung dranzusetzen und sie als Open Data der weltweiten Wissenschaftsgemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Es wären fantastische Daten, weil man damit lange Reihen hätte, die mehr Aufschluss beispielsweise über den Austausch von CO2 zwischen Ökosystem und Atmosphäre geben können.
Große Fortschritte gab es nicht nur bei der Erhebung und Speicherung von Daten – auch was das Teilen von Forschungsdaten betrifft, hat sich viel verändert, oder?
Tappeiner: Absolut. Wer heute in einem angesehenen Journal publiziert, muss die Datenquelle anführen und diese Daten zugänglich machen. Vielfach werden solche Datensätze auch als Open Data zur Verfügung gestellt. Das tun wir mit den Daten unserer ökologischen Langzeitstudie im Matschertal seit Jahren und jetzt auch im Biodiversitätsmonitoring Südtirol.
"Das eigentliche Wesen der Wissenschaft: Es werden Hypothesen generiert, einige konsolidiert, andere revidiert."
Ulrike Tappeiner
In den akuten Krisen Klimawandel und Biodiversitätsverlust: Gibt es Anlass zur Hoffnung, dass uns die riesige Menge verfügbarer Daten wenigstens hilft, Zusammenhänge und Muster besser zu verstehen?
Tappeiner: Das wäre schön. Aber wir wissen noch deutlich zu wenig. Ganz schwierig sind die großen Klimawandel-Modelle, weil dort chaotische und hochkomplexe Systeme zusammenwirken, von der Ökologie über die Ökonomie, Politik und Gesellschaft. Selbst wenn wir die Modelle nur anhand der Treibhausgasemissionen prognostizieren, müssen wir sie immer wieder revidieren. Das ist ja das eigentliche Wesen der Wissenschaft: Es werden Hypothesen generiert, einige konsolidiert, andere revidiert. Unsere Welt ist enorm komplex, die Ökosysteme sind es und das Klima, aber auch der Faktor Mensch. Diese Komplexitätsstufen werden wir, künstliche Intelligenz hin oder her, nie in einem Computer unterbringen. Also arbeiten wir mit vereinfachten Modellen, die trotzdem gute Aussagen darüber zulassen, was da auf uns zukommt.
"Wir können im terraXcube den Einfluss der Atmosphäre auf den menschlichen Organismus zum ersten Mal isolieren und haben damit eine Lehrbuchmeinung widerlegt, wonach der Mensch in der Höhe mehr Urin produziert."
Hermann Brugger
Wie sieht es in der Notfallmedizin mit evidenzbasierten Daten aus?
Brugger: Die Probleme sind ähnlich komplex. Es gibt unendlich viele Variablen im menschlichen Organismus und externe Parameter, die Einfluss darauf nehmen, etwa Temperatur oder Höhe. Hinzu kommt, dass wir Menschen physiologisch alle unterschiedlich sind. Deswegen müssen wir bei der Datenerhebung mit einer enormen Streuung rechnen. Lange Zeit war es nicht möglich, einzelne Parameter herauszugreifen und zu sehen: Was macht jetzt nur die Kälte mit dem Menschen? Was macht die Höhe? Antworten auf diese Fragen erhoffen wir uns von unserem neuen Extremklimasimulator terraXcube, der es ermöglicht, einzelne Parameter ein- und auszuschalten. Ein erstes kleines Aha-Erlebnis gab es schon: Wir können im terraXcube den Einfluss des Drucks, der Atmosphäre, auf den menschlichen Organismus zum ersten Mal isolieren und haben schon mit der ersten Studie eine Lehrbuchmeinung widerlegt, wonach der Mensch in der Höhe mehr Urin produziert. Im Simulator haben wir gesehen, dass die größere Menge an ausgeschiedener Flüssigkeit mit der Plasmaveränderung im Blut zu tun hat und nicht mit den Nieren.
Frau Tappeiner, gab es in Ihrer Forscherkarriere auch so ein Aha-Erlebnis, das bisherige Paradigmen über Bord geworfen hat?
Tappeiner: So einen klassischen Heureka-Moment hatte ich nicht wirklich. Aber überraschende Erkenntnisse schon. Beispielsweise in meiner frühen Studie zum künstlichen Schnee, und wie er die Vegetation beeinflusst. Da haben Untersuchungen am Monte Bondone gezeigt, dass Pflanzen sehr anpassungsfähig sind: Auch wenn die Skipiste erst später ausapert, schafft es die natürliche Vegetation in kürzerer Zeit ihre Phänologie – ihre jahreszeitliche Entwicklung - abzuschließen. Früher dachte man, durch den länger liegenden Kunstschnee wird die Vegetation sehr stark beeinflusst.
Nun sind nicht nur die wissenschaftlichen Daten in Ihren Disziplinen sprunghaft angestiegen, auch die wissenschaftlichen Publikationen. Erleichtert einem das die Arbeit?
Tappeiner: Unbedingt. Früher habe ich einen Monat auf die Kopie eines Fachartikels gewartet, heute logge ich mich ein und bekomme alles sofort. Allerdings wirkt sich die Informationsflut, der auch wir Forschenden zunehmend ausgesetzt sind, oft auch auf die Qualität der Publikationen aus.
Brugger: Forschung hat sich radikal verändert: Wir arbeiten heute über Grenzen hinweg zusammen. In meiner Anfangszeit gab es das Telefon oder eine Konferenz, um sich international auszutauschen. Heute läuft der Produktionsprozess von Publikationen in Lichtgeschwindigkeit ab. Und es gelingt mir selbst in meinem kleinen Fachgebiet nicht zu hundert Prozent up-to-date zu bleiben.
Welche Tipps würde Sie beide heute jungen Forscherkolleginnen und -kollegen geben?
Tappeiner: Das gleiche, was ich mir damals eigentlich auch schon gesagt habe, auf gut Südtirolerisch: net lugg lossn (nicht locker lassen); und auf sich selbst vertrauen. Das ist enorm wichtig, und da tun wir Frauen uns schwerer. Die Glasdecke gibt es auch in der Forschung. Aber in erster Linie muss dich Forschung begeistern, denn reich macht sie dich nicht, oder zumindest selten. Und dann braucht es noch eine Brise Zufall und Glück. Darauf kann man leider keinen Einfluss nehmen.
Brugger: Dieses Gefühl, mit wissenschaftlichen Ergebnissen Neuland zu betreten und mitzuwirken „die Welt zu verbessern“, auch wenn es nur ein minimaler Beitrag ist, möchte ich an die junge Generation weitergeben. Um wissenschaftliche Hypothese in ein handfestes Resultat umzusetzen, braucht es eine gute Portion Hartnäckigkeit. Oft bringt eine Untersuchung ein negatives oder vollkommen anderes Ergebnis, als man erwartet hat, und zwingt uns zur Bescheidenheit. Aber um ein Forschungsziel zu erreichen, muss man auch bereit sein, einen Misserfolg in Kauf zu nehmen und Umwege zu machen. Es ist wie beim Klettern: Die Direttissima ist selten machbar.
Ulrike Tappeiner
Die Ökologin Ulrike Tappeiner leitet seit 1995 das Institut für Alpine Umwelt von Eurac Research. Seit 2005 ist sie Universitätsprofessorin für Ökosystemforschung und Landschaftsökologie an der Universität Innsbruck. Von 2012 bis 2018 stand sie der Fakultät Biologie der Universität Innsbruck als Dekanin vor. Seit 2018 ist sie außerdem Präsidentin der Freien Universität Bozen. In ihrer Freizeit zieht es sie in die Berge. Ihre Lieblingstour ist bis heute der WildeWasserWeg im Stubaital. Wenn sie dort unterwegs ist, weiß sie, warum der Kampf gegen den Klimawandel ihr Herzensthema ist.
Hermann Brugger
Der Notfallmediziner Hermann Brugger hat das Institut für Alpine Notfallmedizin an Eurac Research aufgebaut, und leitete es von 2009 bis 2022. Seit 2006 ist er Privatdozent und Lehrbeauftragter der Medizinischen Universität Innsbruck. 2016-2021 war er Präsident der International Society of Mountain Medicine ISMM. Er ist begeisterter Bergsteiger und Skitourengeher mit zahlreichen Besteigungen in Europa, Amerika und Asien. Wenn Wetter und Arbeit es erlauben, schnallt sich der gebürtige Brunecker seine Tourenski an und ist auf den Bergen im Pustertal unterwegs. Heute sind es eher Genuss-Touren, früher war mehr Nervenkitzel dabei.