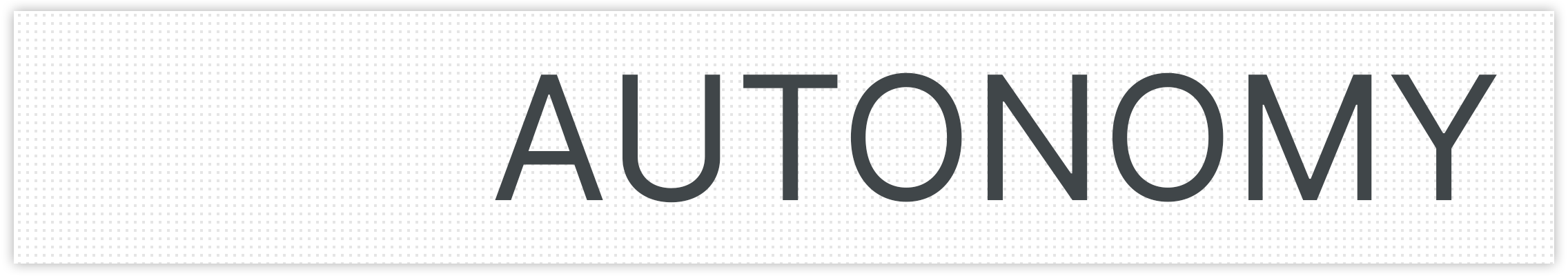magazine_ Interview
„ Rom möchte zunehmend alles selber machen“
Wie viel digitale Autonomie hat Südtirol?
Die Verfassungsrechtlerin Carolin Zwilling
Credit: Eurac Research | Annelie Bortolotti
Südtirols besondere Situation als Minderheitenregion verlange nach einer eigenen Digitalisierungsstrategie, sagt die Landesregierung. Aber wie viel autonomen Handlungsspielraum hat sie überhaupt? Um das zu klären, wurde eine umfassende rechtswissenschaftliche Analyse in Auftrag gegeben. Die Verfassungsrechtlerin Carolin Zwilling leitet das Projekt in Kooperation mit der Universität Innsbruck.
Ihr Report beginnt mit der Analyse auf Ebene der Europäischen Union: Wie detailliert sind die Regelungen dort?
Auf EU-Ebene gibt es schon relativ viele Vorgaben, deutlich mehr als auf nationaler Ebene. Doch hat die EU bei diesem Thema nur eingeschränkte Kompetenzen, das heißt, den Mitgliedstaaten bleibt ein großer Entscheidungsspielraum. Oft gibt die EU nur den Rahmen vor, in dem sich die einzelnen Staaten bewegen müssen, wenn sie ihre nationalen Regelungen treffen. Ob das dann auf zentraler Ebene geschieht oder ob substaatliche Einheiten wie Regionen oder Bundesländer einbezogen werden, ist den Staaten selbst überlassen.
Italien, Deutschland, Österreich und Estland haben Sie Fallstudien gewidmet. Fangen wir mit Italien an: Wie läuft es da?
In Italien haben wir gesehen, dass Rom zunehmend gerne alles selber machen würde, wie in so vielen anderen Bereichen auch. Die bisherigen gesetzlichen Regelungen betreffen aber weniger die Frage, wer die Kompetenz zur Regelung hat, sondern die Abläufe innerhalb der öffentlichen Verwaltung. Also alles, was man unter dem Stichwort E-Government zusammenfassen kann und vor allem die Beziehung zwischen den Bürgern und der Verwaltung als Dienstleister betrifft. Nicht genau geregelt ist hingegen, inwiefern die Regionen ihre eigenen Strategien zur Digitalisierung erarbeiten und dann selbständig umsetzen dürfen. Ebenso wenig werden die Regionen bisher mit einbezogen, wenn der Staat seine Strategien entwickelt.
Also gilt es, den Moment zu nutzen, weil auf nationaler Ebene noch vieles offen ist?
Ja, derzeit könnte es sinnvoll sein, auf politischem Wege, etwa in der Staat-Regionen-Konferenz, Einfluss zu nehmen, um Südtirols besondere Anliegen einzubringen. Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum der Zeitpunkt wichtig ist. Der Wiederaufbaufonds der EU, mit dem die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie eingedämmt werden sollen, stellt Geld für bestimmte Grundpfeiler bereit, in Italien über den PNRR. Digitalisierung ist dabei eines der zentralen Themen: Regionen, die Projekte dazu einreichen, bekommen EU-Gelder. Viele Regionen beantragen diese Fonds beispielsweise, um ihre digitale Infrastruktur auszubauen. Die Südtiroler Landesregierung hat unser wissenschaftliches Forschungsprojekt finanziert, weil sie eine eigene Digitalisierungsstrategie erarbeiten will.
Warum will Südtirol einen eigenen Weg gehen?
Weil die Situation hier durch die verschiedenen Sprachgruppen eine ganz andere ist, andere Bedürfnisse herrschen. Das spiegelt sich natürlich in der Bewertung von Politikfeldern wider. Südtirol hat dank der Autonomie primäre oder sekundäre Zuständigkeit in sehr vielen Politikbereichen, doch in der Liste der Zuständigkeiten findet man nirgendwo den Begriff Digitalisierung. Denn die ist ja kein in sich geschlossenes Politikfeld, sondern durchdringt alle anderen Bereiche – das liegt in der Natur der Sache, und das ist auch das Schwierige daran.
Sollte die nationale Regierung eine Regelung des Landes im Bereich Digitalisierung vor dem Verfassungsgericht anfechten, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass das Gericht ihr Recht gibt.
Carolin Zwilling
Für Südtirol geht es also auch darum zu verhindern, dass sich der Staat über die Digitalisierung in die eigenen Kompetenzfelder einmischt?
Die Sicht in Südtirol ist, dass der Staat alles an sich zieht, was er kann. Hier kommt auch der Verfassungsgerichtshof ins Spiel. Sollte die nationale Regierung eine Regelung des Landes im Bereich Digitalisierung vor dem Verfassungsgericht anfechten, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass das Gericht ihr Recht gibt. Laut der Verfassung hat der Staat eine Koordinierungsfunktion, die das Verfassungsgericht wahrscheinlich sehr weit interpretieren würde – etwa mit der Begründung, der Staat müsse auf seinem Gebiet einheitliche Lebensverhältnisse garantieren. In so einem Fall muss das Land seine Regelung entweder ändern oder überhaupt den staatlichen Vorgaben wortgetreu folgen.
Wurde der autonome Handlungsspielraum durch die Digitalisierung denn schon irgendwo eingeschränkt?
Das ist zu einem gewissen Grad eine Sache der Bewertung. Aber nehmen wir das Beispiel „Sprache auf nationalen Online-Plattformen“: Sieht das System nur die Eingabe auf Italienisch vor – wie derzeit beispielsweise bei verschiedenen staatlich geführten Diensten – hat die Südtiroler Landesverwaltung keine direkte Eingriffsmöglichkeit; gleichzeitig ist sie als zweisprachige Verwaltung jedoch verpflichtet, den Bürgerinnen und Bürgern die Verwendung beider Sprachen zu garantieren. Südtirol muss dann darum kämpfen, dass für Anfragen aus Südtirol nachträglich Sonderregelungen eingeführt werden – was aber mit Mehrkosten verbunden ist, die dann wiederum jemand tragen muss. Ein aktuelles Beispiel ist das neue elektronische Abfallregister „Rentri“, das direkt vom Ministerium für Umwelt und Energiesicherheit verwaltet wird.
Was die Herangehensweise bei solchen Fragen betrifft, wird in Italien oft ein Mangel an föderaler Kultur moniert; in Deutschland dagegen wird gerade der Föderalismus häufig als Hemmschuh für die Digitalisierung bezeichnet.
Das föderale Staatssystem als solches ist mit Sicherheit kein Hemmschuh: Man hat in Deutschland sogar ein eigenes Organ gegründet, in dem Bund und Länder gleichberechtigt durch jeweils eine Person vertreten werden, und das ausschließlich dafür zuständig ist, die Digitalisierung umzusetzen. Was dort ausgehandelt wird, ist verbindlich für alle Bundesländer. Zusätzlich gilt das Prinzip „Einer für alle“: Das bedeutet, dass die Länder im Fall, dass ein Bundesland schon als Vorreiter eine gute Lösung entwickelt hat, voneinander kopieren dürfen. Also da funktioniert die Kooperation, wie übrigens auch in Österreich, wo ebenfalls zwischen Wien und allen Bundesländern grundsätzlich viel und transparent zusammengearbeitet wird.
In Deutschland empfinden die Menschen Digitalisierung oft als einen Eingriff in ihre Grundrechte; in Italien greifen sie sehr viel schneller zu, wenn sie digitale Dienste angeboten bekommen.
Carolin Zwilling
Einen Hemmschuh gibt es in Deutschland aber tatsächlich: die Ablehnung der Digitalisierung durch viele Bürger, aus Angst. Die Menschen empfinden Digitalisierung als einen Eingriff in ihre Grundrechte, verbinden damit den Verlust personenbezogener Daten. Diese Ablehnung ist ein rechtssoziologisches Problem: Etwas kann juristisch noch so gut geregelt sein, die Menschen sperren sich. Der Bundesgesundheitsminister etwa hat Probleme, weil er die digitale Gesundheitsakte vorantreiben will. Dienste, die längst online möglich sind, etwa die Neuanmeldung von Privatfahrzeugen bei den Straßenverkehrsämtern, werden nur selten genutzt. Das geht über Skepsis hinaus und macht es äußerst mühsam, die neuen Technologien in den Köpfen zu verankern.
Ist die Mentalität denn in Italien anders?
Ja, da sehen wir einen großen Unterschied: In Italien greifen die Menschen sehr viel schneller zu, wenn sie digitale Dienste angeboten bekommen, und machen der Politik damit klar, dass man sich den digitalen Transformationsprozess zügiger wünscht. Also Deutschland kommt langsamer voran, weil die Bevölkerung nicht will, und in Italien macht die Bevölkerung mit, aber die Gesetze werden als zu zentralistisch empfunden.
Sie haben auch das digitale Vorzeigeland Estland untersucht, wo es diese Probleme offenbar nicht gibt – was ist dort anders?
Tatsächlich gehen dort technologische Entwicklung, rechtliche Regelung und gesellschaftliche Haltung ziemlich Hand in Hand. Estland hat schon in den neunziger Jahren begonnen, bürokratische Prozesse und Verwaltungsabläufe zu digitalisieren, und hat gleichzeitig Informatik als Pflichtfach eingeführt – die Menschen erwarben also auch gleich die nötigen digitalen Kompetenzen. Estland ist da zwei Generationen voraus.
Was sind nach dieser Analyse Ihre wichtigsten Empfehlungen an die Südtiroler Landesregierung?
Unsere wichtigste ist, sich kooperativ zu zeigen. Mitarbeiten, um auf die Ausgestaltung von Gesetzen Einfluss zu nehmen – auf EU-Ebene zum Beispiel durch Lobbyarbeit oder effektive Teilnahme im Ausschuss der Regionen, auf staatlicher Ebene in der Staat-Regionen-Konferenz über die Landeshauptleute.
Konkret könnte der Landeshauptmann zum Beispiel darauf pochen, dass staatliche Regelungen zur Digitalisierung eine Schutzklausel enthalten, die es Südtirol ermöglicht, von der allgemeinen Regel, sofern diese autonome Zuständigkeiten berührt, abzuweichen bzw. sie um eine Detailregelung zu erweitern.
Eine andere Empfehlung betrifft die kompetenzrechtlichen Grundlagen der Autonomie – es wäre wichtig, die zu festigen, etwa mittels einer Durchführungsbestimmung, mit der Südtirol die Zuständigkeit für Digitalisierung erhält. Darauf sollte man hinarbeiten.
Außerdem empfehlen wir, auf Verwaltungsebene weiterhin digitale Lösungen zu entwickeln, wie man es mit der Plattform My Civis schon getan hat – was einmal existiert und als good governance anerkannt werden muss, das wird einem mit Sicherheit auch nicht wieder weggenommen.
 technical documentation
technical documentationDigiImpact - Digitalisierung und Autonomie Südtirols
Ein gemeinsames Forschungsprojekt des Instituts für vergleichende Föderalismusforschung von Eurac Research und der Universität Innsbruck untersucht derzeit die Auswirkungen der Digitalisierung auf den autonomen Handlungsspielraum der Autonomen Provinz Bozen. Die Studie analysiert die rechtlichen Vorgaben der EU und geht in ausführlichen Länderberichten auf die Erfahrungen in Italien, Österreich, Deutschland und Estland sowie in den Autonomen Provinzen Bozen und Trient und das Bundesland Tirol ein. Zunehmende Digitalisierung, zeigt die Untersuchung, kann zu einer Zentralisierung von Kompetenzen führen. Die Fallstudien zeigen, wie unterschiedlich die Länder damit umgehen. Für Südtirol sei es entscheidend, aktiv an der Gesetzgebung mitzuwirken und die gesetzlichen Grundlagen der Autonomie anzupassen. Wichtig sei außerdem, die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino als Plattform für grenzüberschreitende digitale Zusammenarbeit zu nutzen.