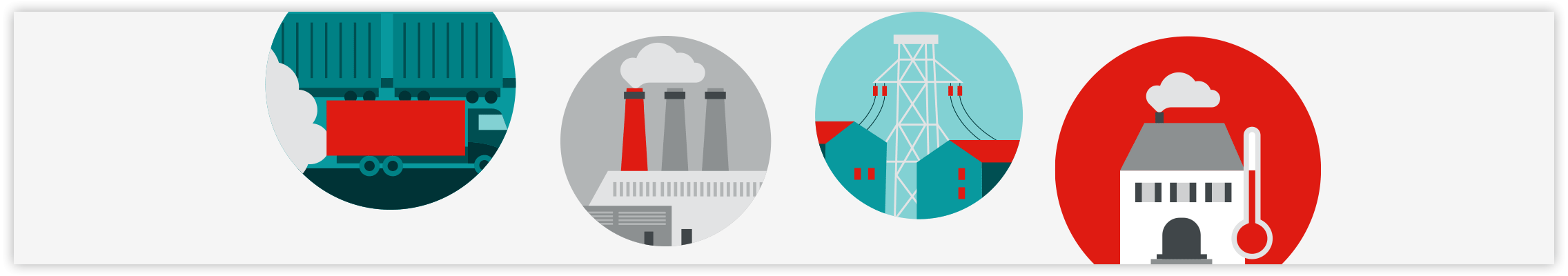magazine_ Interview
„Was nützt Innovation, wenn die Gesellschaft auseinanderbricht?“
Stephan Ortner, Direktor von Eurac Research, über die Erfahrungen in und die Lehren aus der Pandemie
Eurac Research habe seine Erwartungen in diesen schwierigen anderthalb Jahren weit übertroffen, erklärt Direktor Stephan Ortner. Was die Pandemie jedoch über unsere Gesellschaft offenbart hat, lässt ihn zweifeln, ob wir der nächsten, größeren Herausforderung gewachsen sind: der Klimakrise.
Sie haben anderthalb Jahre Krisenmanagement hinter sich: Mit welchem Gefühl blicken Sie zurück?
Stephan Ortner: Ich denke, wir können zufrieden sein – ich sage „wir“, denn an dem Krisenmanagement war eine ganze Task Force aus verschiedenen Bereichen beteiligt: Arbeitssicherheit, Human Resources, Rechtsbüro, Forschung, Kommunikation. Wie wir diese Ausnahmesituation gemanagt haben, wurde von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer anonymen Befragung überwiegend positiv bewertet, was in so einer angespannten, aufgeregten Situation nicht selbstverständlich ist, glaube ich: Da erntet man leicht Kritik, egal, was man tut. Wichtig war dabei sicher, dass wir alle Entscheidungen sehr transparent getroffen haben. Und wir haben rechtzeitig gehandelt – da war uns in der Task Force eine Haltung gemeinsam, die ich salopp so beschreiben würde: Nicht in Deckung gehen und abwarten, sondern die Schaufel in die Hand und hinaus. Eine Pandemie ist ja auch eine Art Charaktertest.
Hat Eurac Research dem Test so standgehalten, wie Sie es erwartet haben?
Ortner: Meine Erwartungen wurden sogar weitaus übertroffen. Da waren so viele Menschen, die gesagt haben: Wir machen was, wir stellen uns der Krise in den Weg, wir helfen. Zum einen die medizinischen Forschungsteams, die Hand in Hand mit dem Sanitätsbetrieb gearbeitet haben, aber nicht nur sie – keiner hat in der Krise erst mal zwei Gänge zurückgeschaltet, im Gegenteil, mir schien, viele haben da erst richtig Gas gegeben. Man sieht es an den abgeschlossenen, akquirierten und neu eingereichten Projekten.
Mit März 2020 wurde für 80 Prozent der Belegschaft Smart Working eingeführt – Home Office mit flexibler Arbeitszeitgestaltung. Hatten sie Zweifel, ob das gutgeht?
Ortner: Zweifel hatten eher einige Institutsleiter. Ich bin schon seit Jahren überzeugt, dass das gut funktionieren kann. Obwohl es während des Lockdowns in Familien mit Kindern natürlich für viele schwierig und belastend war. Aber ein anderes Instrument gab es ja nicht: Wäre so etwas früher passiert, dann hätte Eurac Research ein Jahr lang schließen müssen, wie viele andere Betriebe. Nun verfügen wir über diese Abwehrstrategie – dank der allgemeinen, enormen Entwicklung im Bereich Digitalisierung, einem richtigen Quantensprung. Interessant wird nun sein, was davon man auch in Zukunft beibehält, wo man dagegen zu früheren Arbeitsweisen zurückkehrt.
Forscherinnen und Forscher haben erkennen müssen: Das Eine ist die reine Lehre, das Andere, wie man sie vermittelt und umsetzt.
Stephan Ortner
Eurac Research: Das Pandemie-Jahr in Zahlen
Dass alle Mitarbeitenden regelmäßig ins Büro gehen: Das ist vorbei?
Ortner: Ich glaube ja. Manche werden gerne wieder öfter ins Büro kommen, andere haben vielleicht gemerkt, dass es ihnen liegt, in den eigenen vier Wänden und unabhängiger zu arbeiten. Darüber selbst bestimmen zu können, denke ich, wirkt sich insgesamt positiv auf das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit aus. Gleichzeitig wird man im Auge behalten müssen, dass die Gelegenheiten, sich persönlich zu treffen, nicht zu selten werden, dass man nicht den ein oder anderen in der Isolation verliert. Erst noch zeigen wird sich auch, was all dies für unsere Städte bedeutet – für die Gastbetriebe und all die anderen Dienstleistungen, die am Bürobetrieb hängen. Da kommen Veränderungen und neue Herausforderungen auf uns zu. Unter dem Aspekt Klimaschutz ist es aber natürlich eine sehr positive Entwicklung.
Sie haben es schon angesprochen: Forschungsteams haben eng mit dem Sanitätsbetrieb zusammengearbeitet oder sich mit den Auswirkungen der Pandemie befasst. Kann die Pandemie-Erfahrung der Forschung lokal womöglich auch längerfristig zu mehr Ansehen verhelfen?
Ortner: Der Wert von Forschung ist sehr deutlich geworden, das stimmt. Ob das Bild, das die Forschung abgab, immer das Beste war, sei dahingestellt; man hat eben gemerkt: Forscherinnen und Forscher sind auch nur Menschen. Und in dieser neuen Situation, wo sie sich plötzlich viel stärker auf die Gesellschaft und Politik hin ausrichten mussten, haben sie auch erkennen müssen: Das Eine ist die reine Lehre – das Andere, wie man sie vermittelt und umsetzt. Ich glaube, das war ein Lernprozess für beide Seiten, und im besten Fall ist mehr gegenseitiges Verständnis dabei herausgekommen. Im Ansehen gesunken ist die Forschung sicherlich nicht.
Könnte dies sogar mehr Mittel für die Forschung bedeuten?
Ortner: Da spricht leider dagegen, dass durch die Krise weniger Geld verfügbar ist, und zudem viel gebraucht werden wird, um soziale Härten zu mildern. Jedoch wird Wissenschaft wichtig sein, um die Herausforderungen der Post-Pandemie zu bewältigen – und ich glaube, gerade die Geistes- und Sozialwissenschaften, die es zuletzt eher schwer hatten, an Fördermittel zu kommen, weil technisch-naturwissenschaftliche Innovation als vorrangig galt. Denn das Problem, mit dem wir jetzt konfrontiert sind, ist eine zutiefst gespaltene Gesellschaft. Das löst keine Impfung. Da sind Parallelwelten entstanden, die mit wissenschaftlichen Fakten nicht zu erreichen sind. Die Frage ist: Wie schaffen wir es, hier überhaupt erst wieder eine gemeinsame Gesprächsebene zu finden? Da sind jetzt weniger die Naturwissenschaften gefragt, denke ich. Denn was nützt Innovation, wenn die Gesellschaft auseinanderbricht?
Wie wollen wir der Klimakrise entgegentreten, wenn wissenschaftliche Argumente zu einem Teil der Gesellschaft nicht mehr durchdringen?
Stephan Ortner
Die Geistes- und Sozialwissenschaften werden also neue Bedeutung gewinnen?
Ortner: Ja, da sehe ich großen Bedarf. In meinen Augen war die Spaltung, die sich hier offenbart hat, nämlich nur ein Vorgeschmack auf das, was uns in Bezug auf die Klimakrise erwartet: Wie wollen wir der entgegentreten, wenn wissenschaftliche Argumente zu einem Teil der Gesellschaft nicht mehr durchdringen? Oder ein anderes großes Thema, das uns beschäftigten muss: die Schwächen von demokratischen Systemen; eine Umfrage, ob Demokratie eine tolle Sache ist, ergäbe nach der Pandemie sicher andere Ergebnisse als davor. Darin liegt eine Gefahr. Oder die zunehmende Ungleichheit. Auch die fatale Rolle, die soziale Medien spielen, mit ihrem Dauerstreit, der Einteilung der Welt in Gut und Böse. Die Pandemie hat unsere Gesellschaft wie ein Röntgengerät durchleuchtet, eineinhalb Jahre lang, und alle Schwächen ans Licht gebracht.
Welche Lehre sollten wir Ihrer Meinung nach daraus ziehen?
Ortner: Eines wurde sehr deutlich, denke ich: Eine Gesellschaft, die in normalen, friedlichen Zeiten schon so zersplittert und zerstritten ist, kann mit Problemen solcher Dimension schlecht fertig werden. Wir brauchen wieder ein Gemeinschaftsgefühl, etwas Verbindendes, das uns hilft, uns als Gesellschaft zu behaupten – das hat nichts mit Nationalismus zu tun, oder damit, die Stärkeren sein zu wollen. Wir können die sein, die besonders hilfsbereit sind, oder die sich besonders gut an die natürlichen Bedingungen anpassen. Wenn wir nach Asien schauen – und ich meine nicht die autoritären Systeme –, dann sehen wir: Gesellschaften, in denen der Respekt vor dem Mitmenschen größer ist, waren in der Pandemie resilienter.